„Umkehr“ in der Verkündigung von Jesus
Joachim Jeremias schreibt über die „Umkehr“ in der Verkündigung von Jesus (Neutestamentliche Theologie: Erster Teil, 1988, S. 151–152):
Jesus sieht die Menschen in ihr Verderben rennen. Es steht alles auf des Messers Schneide. Es ist letzte Stunde. Die Gnadenfrist läuft ab. Unermüdlich weist er auf die Bedrohlichkeit der Situation hin. Siehst du nicht, sagt er, daß du in der Lage des Beklagten bist, der vor dem Gerichtshaus steht und dessen Prozeß hoffnungslos ist? Es ist die letzte Minute, dich mit deinem Gegner zu vergleichen (Mt 5,25f. par. Lk 12,58f.). Siehst du denn nicht, daß du in der Lage des Verwalters bist, dem das Messer an der Kehle sitzt, weil seine Betrügereien aufgedeckt sind? Lerne von ihm! Er läßt die Dinge nicht treiben, er handelt resolut, wo alles auf dem Spiel steht (Lk 16,1–8a, erweitert durch kommentierende Logien V. 8b-13). Jeden Augenblick kann der Ruf erschallen: der Bräutigam kommt; dann zieht der Hochzeitszug mit den Fackeln* in den Festsaal, und die Tür wird verschlossen, unwiderruflich. Sorge dafür, daß du Öl für die Fackel hast (Mt 25, 1–12). Leg das Hochzeitsgewand an, ehe es zu spät ist (Mt 22,11–13). Mit einem Wort: Kehre um, solange es noch Zeit ist.
Die Umkehr, das ist die Forderung der Stunde. Umkehr ist nötig nicht nur für die sogenannten Sünder, sondern ebenso, ja noch mehr, für die, die nach dem Urteil der Umwelt „der Buße nicht bedurften“ (Lk 15,7), für die Anständigen und Frommen, die keine groben Sünden begangen hatten; für sie ist die Umkehr am dringlichsten.
Was meint Jesus aber, wenn er fordert: Kehrt um? Wieder ist typisch, daß die Vokabeln metanoia und metanoein kein erschöpfendes Bild geben von dem, was Jesus unter Umkehr verstehts. Eine deutlichere Sprache reden die Gleichnisse; am klarsten und schlichtesten sagt es das Gleichnis vom verlorenen Sohn“. Die Wende seines Lebens wird umschrieben mit seis eauton de eltwn (Lk 1S, 17), hinter dem ein aramäisches hadar beh stehen dürfte, das nicht wie die griechische Formulierung „er kam in vernünftige Geistesverfassung“, sondern „er kehrte um“ bedeutet. Dabei ist das erste, daß er seine Schuld bejaht (V. 18). So bejaht auch der Zöllner seine Schuld: „Er wagte ess nicht, die Augen zum Himmel zu erheben“, geschweige denn (so ist zu ergänzen) die Hände (Lk 18,13). Statt des üblichen Gebetsgestus der erhobenen Hände und Augen schlägt er sich verzweifelt an die Brust mit den Anfangsworten des s r. Psalms, die er um den (adversativ gemeinten!) Dativ tã Quaotalã erweitert: „O Gott, sei mir gnädig, obwohl ich so sündig bin.“ Die Meinung ist wohl, daß der Zöllner den ganzen Bußpsalm gebetet habe: „Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deinem großen Erbarmen. Wasche mich rein von meiner Schuld, reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat, und meine Sünde steht mir immer vor Augen …“ Diese Bejahung der Schuld hat nicht nur vor Gott zu geschehen, sondern auch vor den Menschen. Sie äußert sich in der Bitte um Vergebung an den Bruder (Mt 5,23f.; Lk 17,4) und im Mut zum öffentlichen Sündenbekenntnis (19,8).
Umkehr ist nun aber mehr als Reue. Sie ist Abkehr von der Sünde. In immer neuen Bildern fordert Jesus diese Abkehr, und zwar stets konkret, von jedem in seiner Lage. Vom Zöllner erwartet er die Abkehr vom Betrug (Lk 19,8), vom Reichen die Abkehr von der Mammonsherrschaft (Mk 10, 17–31), vom Eitlen die Abkehr von der Hoffart (Mt 6,1–18). Wer einem anderen Unrecht getan hat, soll es wiedergutmachen (Lk 19,8). Hinfort soll der Gehorsam gegen Jesu Wort das Leben bestimmen (Mt 7,24–27), das Bekenntnis zu ihm (Mt 10,32f. par.), die Nachfolge, die allen anderen Bindungen vorgeht (V. 37 par.).
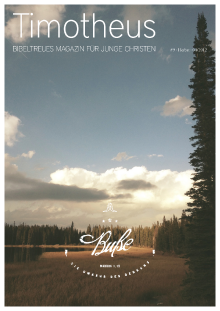 Ausgabe 9 des Magazins Timotheus ist erschienen. Diesmal geht es um ein Thema, über das heute kaum noch gepredigt und gesprochen wird: die Buße.
Ausgabe 9 des Magazins Timotheus ist erschienen. Diesmal geht es um ein Thema, über das heute kaum noch gepredigt und gesprochen wird: die Buße.