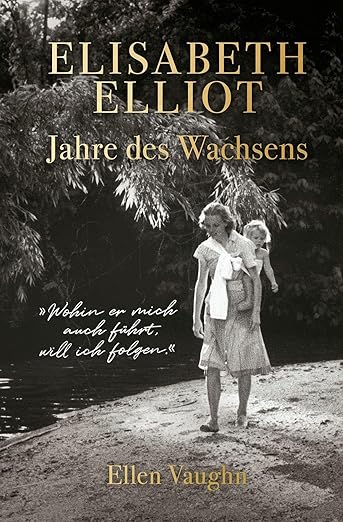Der Preis der Spezialisierung
Der Romanist Gerhard Poppenberg bedauert in „Das Leben des Geistes“ die Abwertung der Geisteswissenschaften und macht dabei auf zwei wichtige Sachverhalte aufmerksam (FAZ, 25.02.26, Nr. 47, S. N4).
Erstens erklärt Poppenberg, dass wir bei aller vermeintlichen „Faktizität“ Dinge wie Naturphänomene immer auslegen. O-Ton:
Warum und wozu brauchen wir Geisteswissenschaften? Philosophie und Kunst, Literatur und Geschichte sind Teil der westlichen Zivilisation. Ideen, Bilder, Geschichten und Erinnerungen machen die Verfassung des menschlichen Geistes aus. Die Philosophie zeigt, dass Gedanken und Begriffe eine historische Dimension haben. Sie entfalten sich im Laufe der Zeit durch Differenzierung und setzen so ihre Wahrheit nach und nach frei. Bei Worten und Bildern, Mythen und Geschichten verhält es sich entsprechend. Diese Dynamik, so Gadamer in der Nachfolge Hegels, bildet das Leben des Geistes.
Die Erklärung beispielsweise von Naturphänomenen ist immer auch in eine Auslegung der Welt, der Natur und des Menschen eingebunden. Es ist ein bedeutender Unterschied, ob die Welt griechisch als physis und kosmos, christlich als Schöpfung und gefallene Welt oder wissenschaftlich als naturgesetzmäßig geordnete Ansammlung von Atomen, hervorgegangen aus einem Urknall, konzipiert wird. Welt ist nicht einfach da, sie wird immer schon gedeutet. Und sich darüber Klarheit zu verschaffen, ist die Aufgabe jeder historisch ausgelegten Forschung. Sie zeigt, dass es auch anders sein könnte und dass Veränderungen des leitenden Deutungsmusters zu Veränderungen im Weltbild führen können.
Zweitens spricht er an, dass wir heutzutage durch eine immer weitergehende Spezialisierung verlernt haben, in Zusammenhängen zu denken:
Vergangenes Jahr hat der Historiker Dieter Langewiesche eine Studie über die im 19. Jahrhundert bis tief ins 20. Jahrhundert an Universitäten regelmäßig gehaltenen Rektoratsreden vorgelegt. Auffällig ist, dass in den Reden ein Grundgedanke über alle Fächer und alle Zeiten hinweg gleich blieb. „Die Universität ist ein Ort der Forschung und deshalb eine Bildungsinstitution.“ Das Bildende der Forschung liege im wissenschaftlich-methodisch ausgerichteten Zugang zur Welt, der nicht nur für einen besonderen Beruf qualifiziere, sondern darüber hinaus grundlegende Fähigkeiten ausbilde. Das Ziel war ein „Habitus, den man im Studium erwirbt und sich lebenslang bewahrt“: eine Form von Urteilskraft, die neue Probleme anzugehen und mit Unvorhergesehenem und Unbekanntem umzugehen versteht.
Dieser Grundgedanke wird mit zunehmender Differenzierung und Spezialisierung der Fächer immer problematischer. Schon vor hundert Jahren stellten Fachwissenschaftler ernüchtert fest, dass sie Mühe hatten, etwa als Physiker von der ingenieurwissenschaftlichen Mechanik über die Teilchenphysik bis zur Astrophysik das gesamte Fach im Einzelnen im Blick zu haben – von anderen Fächern zu schweigen.
Das gilt heute endgültig, und zwar nicht nur für ganze Fachkomplexe, denn die Spezialisierungen reichen inzwischen bis in die Spezialgebiete eines Faches.