Die Gesellschaften triften immer weiter auseinander. Debatten gewinnen jene, die den stärksten Druck ausüben, ob in der Klimapolitik, der Bildung oder der Genderpolitik. Es gibt nicht um Vernunft, Argumente und gemeinsame Lösungsansätze, sondern um Macht. Die Schweizer Journalistin Claudia Wirz hat in der NZZ einen eindrucksvollen Beitrag zur Diskussionskultur geschrieben und dazu aufgefordert, mehr Fragen im sokratischen Sinne zu stellen.
Als ein Beispiel dient ihr eine Journalistin, die einmal angefangen hat, Fragen zur staatlichen Frauenförderung zu stellen:
Und so stellt sie Fragen zu staatlicher Frauenförderung. Sie fragt, ob die Frauen diesen «safe space» überhaupt brauchen. Ob eine zentralistische Frauenförderung die Frauen nicht erst recht entmündigt? Sie fragt, ob die Frauen etwas merken würden, wenn alle Gleichstellungsbüros auf einmal geschlossen würden; ob Frauenquoten zum Geist des Rechtsstaats passen. Ist nicht der Grundsatz, dass vor dem Gesetz alle gleich sind, eine Errungenschaft aufgeklärter Gesellschaften?
Auch will die Journalistin wissen, was es mit der Gendersprache auf sich hat. Kann die Chefin belegen, dass Frauen durch Wörter wie «Fussgängerstreifen» wirklich systematisch diskriminiert werden? Und kann sie belegen, dass «Zebrastreifen» tatsächlich die frauenfreundlichere Variante ist? Verdrängt das Zebra die Frau nicht genauso, wie es der Fussgänger tut, oder sogar noch mehr? Die Chefin erklärt, dass Quotenregelungen notwendig seien und auch keine Diskriminierung darstellten, bis die Frauen endlich «angemessen» vertreten seien.
Wirz erwähnt noch ein zweites Beispiel: Eine Zürcher Gemeinderätin sollte von einem rot-grünen Gremium gezwungen werden, einen Text in gendergerechter Sprache abzufassen. Die Unbeugsame konnte sich der erzwungenen Sprache nur entziehen, in dem sie rechtlichen Beistand in Anspruch nahm:
Das liess die Gemeinderätin nicht auf sich sitzen und rekurrierte beim Bezirksrat. Sie und ihr Anwalt Lukas Rich hatten eine ganze Palette von Argumenten auf ihrer Seite: Der Gemeinderatsbeschluss habe keine rechtliche Grundlage, sei willkürlich. Er verstosse gegen das Verbot des überspitzten Formalismus als besondere Form der Rechtsverweigerung, verletze die politischen Rechte der Gemeinderätin und missachte den Grundsatz der Verhältnismässigkeit sowie den Anspruch auf Meinungsfreiheit. Ein Zwang zum Gendern zielt also – zumindest aus der Sicht der Rekurrentin – mitten ins Herz der Demokratie.
Der Bezirksrat hiess den Rekurs gut. Er kam zu dem Schluss, dass es für eine autoritäre Durchsetzung der Gendersprache keine gesetzliche Grundlage gibt.
Kurz: „So betrachtet lässt die Unerbittlichkeit der Gemeinderatsmehrheit tiefe Einblicke in deren Demokratieverständnis zu. Ausgerechnet jene Kreise, die sonst nicht genug von Toleranz, Diversität und Inklusion sprechen können, versuchen auf diese indirekte Weise den politischen Gegner auszubremsen. Toleranz mit den Gleichgesinnten – Intoleranz gegenüber allen anderen.“
Ein uneingeschränkte Leseempfehlung: www.nzz.ch.
VD: PP
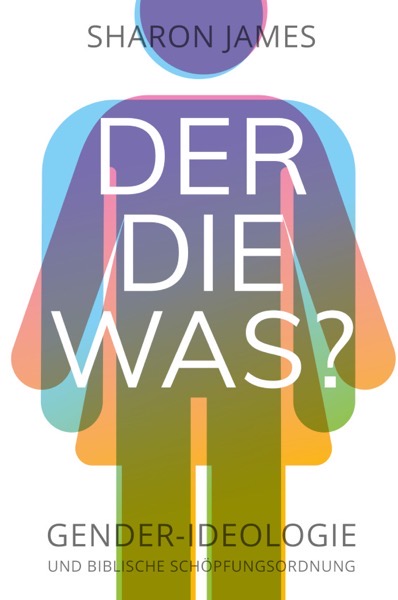 Peter Prock stellt das Buch Der, die, was? für E21 vor:
Peter Prock stellt das Buch Der, die, was? für E21 vor: