Judith Butler hat etwas bewegt
Die Stadt Frankfurt am Main hat am Dienstag Judith Butler mit dem Adorno-Preis geehrt. Der Tenor in der Medienberichterstattung war einhellig: Butlers Haltung gegenüber Israel ist anfechtbar, ihre Beiträge zur Gender-Problematik haben dagegen weitgehende Akzeptanz gefunden.
Eva Geulen, selbst Butler-Expertin und die Laudatorin des Abends, packte ihre Bewunderung für die Preisträgerin in den Satz: „Sie hat etwas bewegt.“ Der CDU Politiker Felix Semmelroth stellte vornehmlich ihre Leistungen für die Gender-Theorie heraus: „Ihre Stimme, und das macht auch ihre Verantwortung als öffentliche Intellektuelle aus, wird nicht nur gehört, sondern hat Gewicht, wird wahr- und ernstgenommen und dies natürlich nicht immer mit Zustimmung oder gar Wohlgefallen.“
Bei so viel Überschwang für Judith Butler bin ich gestern mit einem ihrer Standardwerke ins Bett gegangen. Ungefähr zwei Stunden habe ich mit dem Unbehagen der Geschlechter (Suhrkamp, 1991) verbracht.
Das Buch ist eine Streitschrift gegen die „Zwangsheterosexualität“ und den „Phallogozentrismus“, ein Versuch, Geschlechterordnungen zu (ver)stören. Konstruktionen von Geschlechtern sind für Butler Ausdruck politischer und gesellschaftlicher Machtdiskurse. Sogar das Inzestverbot wurde erschaffen, um die herrschende heterosexuelle Geschlechterordnung zu verfestigen.
Über allem steht die Attacke auf die binäre Ordnung. Butler treibt die Unterscheidung von biologischem Geschlecht (sex) und „seelischer“ Geschlechtsidendität (gender) soweit, dass sie die Geschlechtstidentität nicht nur vom biologischen Geschlecht entkoppelt, sondern – in gewisser Weise konsequent – behauptet, dass Gender dem biologischen Geschlecht immer schon vorausgeht. So verflüssigen sich nicht nur biologische Grenzen, sondern auch sozial konstruierte Geschlechtsidentitäten erweisen sich als unbestimmt.
Wenn wir jedoch den kulturell bedingten Status der Geschlechtsidentität als radikal unabhängig vom anatomischen Geschlecht denken, wird die Geschlechtsidentität selbst zu einem freischwebenden Artefakt. Die Begriffe Mann und männlich können dann ebenso einfach einen männlichen und einen weiblichen Körper bezeichnen wie umgekehrt die Kategorien Frau und weiblich (S. 23).
Butler will jeden Rest einer binären Unterscheidung wegspülen, um die Konfigurationen von Geschlechteridentitäten erweitern zu können. Dem humanistischen Feminismus wirft sie deshalb vor, dass er Geschlechtsidentität noch als „Attribut einer Person“ begreifen will (S. 28). „Als sich ständig verschiebendes (shifting) und kontextuelles Phänomen bezeichnet die Geschlechtsidentiät nicht ein substantiell Seiendes, sondern einen Schnittpunkt zwischen kulturell und geschichtlich spezifischen Relationen“ (S. 29).
Butler hat wirklich etwas bewegt. So manches Unbehagen der Geschlechter ist bereits in den Grundschulen angekommen. Das Konzept der Geschlechtsidentität soll in ein überarbeitetes Grundgesetz einfließen. Butler hat eben Gewicht, also Macht. Vielleicht sollte sich jemand die Mühe machen, ihre Thesen so zu formulieren, dass sie falsifizierbar, also überprüfbar, sind. Vermutlich würde sich schnell herausstellen, dass die Genderkönigin nichts an hat (vgl. hier).
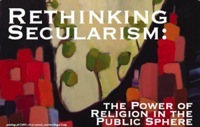 Am 22. Oktober kam es zu einem Zusammentreffen von Judith Butler, Charles Taylor, Cornel West und Jürgen Habermas. Das Symposium »Rethinking Secularism: the Power of Religion in the Public Sphere« bot folgende Vorträge an:
Am 22. Oktober kam es zu einem Zusammentreffen von Judith Butler, Charles Taylor, Cornel West und Jürgen Habermas. Das Symposium »Rethinking Secularism: the Power of Religion in the Public Sphere« bot folgende Vorträge an: