Wahrheiten und Mehrheiten
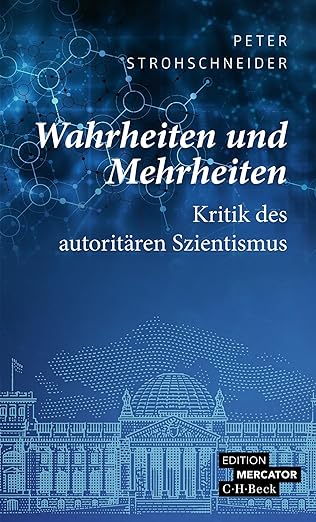
Ob Klima-, Umwelt- oder Gesundheitskrise: Die Machtworte der Wissenschaft verheißen – so argumentieren viele Politiker und Journalisten – Abhilfe. Tatsächlich aber verbündet sich hier naive Wissenschaftsgläubigkeit mit einem tendenziell undemokratischen Machtanspruch. Jakob Hayner stellt das Buch Wahrheiten und Mehrheiten von Peter Strohschneider vor, in dem der heute so verbreitete Szientismus unter die Lupe genommen wird:
Mit klarer Argumentation und nüchterner Analyse nimmt Strohschneider auf knapp 200 Seiten einige der Irrtümer über Wissenschaft und Politik auseinander, die in den vergangenen Jahren geradezu endemisch geworden sind. Der 1955 geborene Strohschneider ist zwar von Beruf Literaturwissenschaftler, war aber auch langjähriger Vorsitzender des Wissenschaftsrats und der Deutschen Forschungsgemeinschaft, zudem Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Kurz: Hier spricht ein Mensch der Wissenschaft aus intimer Kenntnis der Sache.
„Wahrheiten und Mehrheiten. Zur Kritik des autoritären Szientismus“ heißt das Buch von Strohschneider. Szientistisch, in Abgrenzung zu szientifisch (schwer einzudeutschen: wissenschaftistisch statt wissenschaftlich), nennt Strohschneider die „Follow the Science“-Pose, die allein „die Fakten“, aber keinerlei Erkenntnis- und sonstige Wissenschaftsprobleme kennt, sondern ausschließlich einen alternativlos wirkenden Handlungsdruck aufbaut. Zu finden ist das bei Gruppierungen wie „Scientists for Future“ oder bei Leuten, die es wie der SPD-Politiker Karl Lauterbach vom Twitter-Troll zum Minister gebracht haben.
Ein Zitat aus dem Buch (Wahrheiten und Mehrheiten: Kritik des autoritären Szientismus, 2004, S. 135–136):
So „sorgt die Rhetorik des Notstands für despotische Verhältnisse,“ und dieser Schritt lässt sich nicht nur in politischen Stellungnahmen wie denjenigen der Jugendklimabewegung oder von Karl Lauterbach verfolgen, sondern auch an gesellschaftstheoretisch erheblich ambitionierteren Beispielen. So hat etwa der Soziologe Anthony Giddens, in den neunziger Jahren einer der intellektuellen Väter des britischen New Labour-Projektes, schon vor über einer Dekade in seinem Buch The Politics of Climate Change durchbuchstabiert, wie manifestes Politikversagen behoben werden könne, indem man diese Politics um alles Politische programmatisch bereinige. Es müsse „der scharfe Gegensatz von Links und Rechts sowohl ideologisch als auch in der parteipolitischen Praxis überwunden werden […].“ Denn tatsächlich bestehe längst kein sachlicher Dissens mehr über das, was bei der Bekämpfung des Klimawandels ‹eigentlich› erforderlich sei. Vielmehr seien es allein politische Gegnerschaften, welche die richtigen Entscheidungen behinderten. Und gegen diese Blockaden durch das Politische empfahl Giddens nun einen parteiübergreifenden monitoring body. Dieser sollte die Verfolgung von Klimaschutzzielen nicht bloß überwachen, sondern gegebenenfalls auch selbst direkt in die entsprechende Gesetzgebung eingreifen. Unüberhörbar ist, dass dieser klimapolitische Herrschaftsentwurf bis in jene Vorstellungen des bundesrepublikanischen Gesundheitsministers hinein nachhallt, nach welchen Politik durch Szientifizierung ertüchtigt werden soll.
Mehr (hinter einer Bezahlschranke): www.welt.de.
[#ad]