Richard Schaefflers Erkenntnislehre
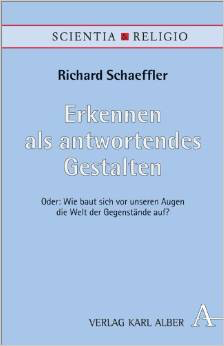 Kant hat die Frage nach den Bedingungen gestellt, die es möglich machen, dass uns überhaupt etwas als Gegenstand gegenübertritt. Seine Antwort auf die so verstandene „transzendentale Frage“ lautete, dass die Formen unseres Anschauens und Denkens den Gegenständen ihre Gesetze vorschreiben. Der katholische Philosoph Richard Schaeffler versucht, die Einseitigkeit der kantischen Rede von einer „Gesetzgebung“ des Subjekts über die Gegenstandswelt zu überwinden und das Verhältnis zwischen dem Subjekt und seinen Gegenständen als ein dialogisches Verhältnis zu beschreiben. Der Alber Verlag schreibt über sein jüngstes Buch Erkennen als antwortendes Gestalten: Oder: Wie baut sich vor unseren Augen die Welt der Gegenstände auf?:
Kant hat die Frage nach den Bedingungen gestellt, die es möglich machen, dass uns überhaupt etwas als Gegenstand gegenübertritt. Seine Antwort auf die so verstandene „transzendentale Frage“ lautete, dass die Formen unseres Anschauens und Denkens den Gegenständen ihre Gesetze vorschreiben. Der katholische Philosoph Richard Schaeffler versucht, die Einseitigkeit der kantischen Rede von einer „Gesetzgebung“ des Subjekts über die Gegenstandswelt zu überwinden und das Verhältnis zwischen dem Subjekt und seinen Gegenständen als ein dialogisches Verhältnis zu beschreiben. Der Alber Verlag schreibt über sein jüngstes Buch Erkennen als antwortendes Gestalten: Oder: Wie baut sich vor unseren Augen die Welt der Gegenstände auf?:
[Schaeffler] zeichnet den antwortenden Charakter unseres Erkennens Schritt für Schritt auf allen Stufen des Erkennens nach: in den Akten der Wahrnehmung, ohne die alle Formen der Begriffsbildung inhaltslos bleiben, in den Akten des Begreifens, durch die wir unsere subjektiven Eindrücke erst in objektiv gültige Erkenntnisse verwandeln, und schließlich in der Beschreibung des Vorgangs, in welchem sich der Gegenstand all unseren Gestaltungsversuchen immer wieder „entgegenwirft“ und so erst zum „Objectum“ und zum Maßstab unserer Selbstbeurteilung werden kann. Diese dialogische Betrachtungsweise macht die Widersprüche deutlich, in die die Vernunft sich verwickelt, wenn sie sich einseitig als „Gesetzgeberin“ versteht. Aus diesen Widersprüchen kann sie sich befreien, indem sie die Impulse zum antwortenden Gestalten wie auch die Ergebnisse ihres Gestaltens als Entsprechungen einer göttlichen Gesetzgebung versteht.
Christoph Böhr hat in seiner Rezension „Ein Theologischer Realist“ über das erkenntnistheoretische Spätwerk Richard Schaefflers geschrieben (FAZ, 19.08.2015, S. N3):
Am Ende der Postmoderne steht Ratlosigkeit. Welchen Weg soll die Philosophie einschlagen? Richard Schaeffler (geboren 1926, bis zu seiner Emeritierung in Bochum lehrend) versucht eine Antwort, indem er jener Frage nachgeht, die das neuzeitliche Denken in Bewegung hielt: Was ist gemeint, wenn wir sagen, eine Sache „erkannt“ zu haben? Konstruktivismus wie Dekonstruktivismus sehen die Antwort entschwinden. Während sich große Teile der Philosophie auf diese oder jene Seite schlagen, zugleich aber auch ein neuer Realismus Fahrt aufnimmt, öffnet Schaeffler den Blick für eine neue Sicht der Dinge: Unser Denken, so seine vermittelnde Behauptung, antwortet auf eine Wirklichkeit, die ihm im Eigenstand der Dinge gegenübersteht; in der Empfängnis des Seins der Wirklichkeit allerdings gestaltet unser Denken deren Erkenntnis. Dinge gerinnen zum Bild, indem wir im Erkennen dessen, was wir wahrnehmen, auf deren Widerständigkeit antworten.
VD: JS