Die Mär von der Freiwilligkeit des Genderns
Staatsminister Wolfram Weimer hat in seiner Behörde Gendersonderzeichen verboten und dafür viel Kritik geerntet. Vor allem wird behauptet, dass dieses Verbot ideologisch motiviert sei, da es nie enen Genderzwang gegeben hatte. Fabian Payr verteidigt das Vorgehen von Wolfram Weimer.
Vielfach wird Weimer vorgeworfen, er verböte mit seinem Vorstoß etwas, was nirgends geboten sei. Er beantworte Nichtzwang mit Zwang. Genderzwang – ein Phantasieprodukt? Samira El Ouassil schreibt im „Spiegel“: „Es musste vorher niemand gendern, wohlgemerkt, aber jetzt darf es dank der neuen Sprachpolizei auch niemand mehr.“ Will man einen Zwang zum Gendern empirisch belegen, wird man sicher nicht hinter der Bäckereitheke fündig, in der Schreinerwerkstatt oder beim Schneider. Anders im universitären Milieu, wo laut der Bundeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen rund 700 „Gleichstellungsakteur*innen“ sich auch mit dem Sprachgebrauch an den Unis befassen. Die von ihnen erstellten „Leitfäden“ zum geschlechtergerechten Sprachgebrauch sind „Empfehlungen“, entfalten aber eine erstaunliche normative Kraft: Wissenschaftler bringen ihre Aufsätze nicht in Fachzeitschriften oder Fachpublikationen unter, wenn diese nicht gegendert sind, Anträge auf Fördermittel haben in ungegenderter Form keine Chance auf Bewilligung, und Studenten müssen mancherorts mit Punkteabzug rechnen, wenn ihre Arbeiten nicht gegendert sind. Als die „Zeit“ 2023 Universitäten zu ihrem Umgang mit Gendersprache befragte, antworteten 41 von 132 Einrichtungen auf die Frage „Ist es Professoren und anderen Dozenten an Ihrer Hochschule freigestellt, geschlechtergerechte Sprache in Prüfungsleistungen einzufordern?“ mit Ja.
Dass der Gebrauch von Gendersprache keine Sache der Freiwilligkeit ist, belegen auch die vielen teils seit Jahrzehnten gültigen Gesetze und amtlichen Regelungen, die den Sprachgebrauch im öffentlichen Dienst regeln. Wer unbefangen hinschaut, wird ihn entdecken – den Genderzwang in Behörden, Stadtverwaltungen, Ministerien und Firmen. Und es sind beileibe keine exotischen Einzelfälle, wie gern kolportiert wird. Der Soziologe Steffen Mau berichtet 2023 in einem „Spiegel“-Interview, dass ihn ein Bundesministerium zu einem Vortrag eingeladen hatte. Vertraglich sollte er sich verpflichten, „geschlechtergerechte Sprache zu nutzen“. Mau, der in seinen Publikationen selbst gendert, war irritiert: „Ich spreche gern geschlechtergerecht, aber freiwillig.“ Wenn Kulturstaatsminister Weimer also von „erzwungenem Gendern“ spricht, dann beschreibt er einen in vielen Bereichen tatsächlich existenten und nicht eingebildeten Druck zum Gendern.
Die gegen Weimer vorgebrachten Argumente erweisen sich als wenig substanziell, teils sogar kontrafaktisch, wie etwa die Mär von der Freiwilligkeit des Genderns. Sie verschleiern, dass Weimer einen reichlich harmlosen Vorstoß „gewagt“ hat: Er fordert von seinen Mitarbeitern die Beachtung geltender orthographischer Regeln. Macht ihn das zum Kulturkämpfer? Weimer unterstreicht: „Wer im öffentlichen Auftrag spricht, sollte eine Sprache wählen, die für alle nachvollziehbar ist und breite Akzeptanz findet.“ Ein Kulturstaatsminister hat nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, dafür Sorge zu tragen, dass unsere Sprachgemeinschaft imstande ist, sich in einer allgemein verständlichen Sprache mit allgemein gültigen Regeln zu verständigen.
Mehr: zeitung.faz.net.
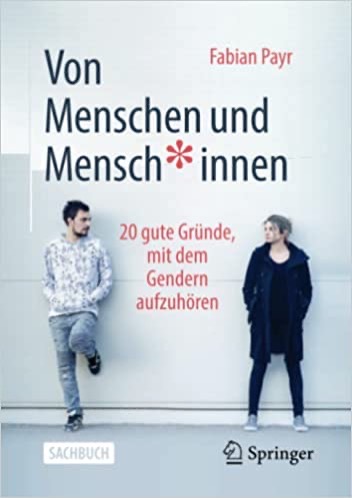 Die Debatte um eine geschlechtergerechte Sprache hat das Potential, die Gesellschaft noch weiter zu spalten. Einerseits wird das Gendern von öffentlichen Behörden, Universitäten und bei manchen Medien „verordnet“, andererseits empfinden immer mehr Menschen diese verordneten Eingriffe in die Sprache als Bevormundung. Die Progressiven machen freilich einfach weiter und gehen davon aus, dass sich die Mehrheit an die neue Sprache gewöhnen wird. Nur dann, wenn die Sprache verändert werde, könnten patriarchische Strukturen durchbrochen und Frauen endlich sichtbar gemacht werden, meinen sie.
Die Debatte um eine geschlechtergerechte Sprache hat das Potential, die Gesellschaft noch weiter zu spalten. Einerseits wird das Gendern von öffentlichen Behörden, Universitäten und bei manchen Medien „verordnet“, andererseits empfinden immer mehr Menschen diese verordneten Eingriffe in die Sprache als Bevormundung. Die Progressiven machen freilich einfach weiter und gehen davon aus, dass sich die Mehrheit an die neue Sprache gewöhnen wird. Nur dann, wenn die Sprache verändert werde, könnten patriarchische Strukturen durchbrochen und Frauen endlich sichtbar gemacht werden, meinen sie.