Kritik des neuronalen Determinismus
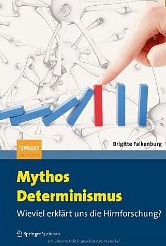 Wie viel erklärt uns die Hirnforschung? Aus Sicht von Neurobiologen regiert das neuronale Geschehen im Kopf unser Bewusstsein. Brigitte Falkenburg vertritt in ihrem Buch Mythos Determinismus einen neuen Ansatz bei der Kritik des Determinismus. Als Physikerin und Philosophin hinterfragt sie die Aussagen von Hirnforschern und stellt fest, dass die Neurobiologie an längst überholten mechanistischen Vorstellungen festhält und dadurch zu Fehlschlüssen über den menschlichen Geist und den freien Willen gelangt.
Wie viel erklärt uns die Hirnforschung? Aus Sicht von Neurobiologen regiert das neuronale Geschehen im Kopf unser Bewusstsein. Brigitte Falkenburg vertritt in ihrem Buch Mythos Determinismus einen neuen Ansatz bei der Kritik des Determinismus. Als Physikerin und Philosophin hinterfragt sie die Aussagen von Hirnforschern und stellt fest, dass die Neurobiologie an längst überholten mechanistischen Vorstellungen festhält und dadurch zu Fehlschlüssen über den menschlichen Geist und den freien Willen gelangt.
Alexander Soutschek hat für Gehirn und Geist das Buch rezensiert:
Die Frage, ob und inwiefern die Erkenntnisse der Neurowissenschaften unser Menschenbild verändern, ist seit Langem Gegenstand hitziger Debatten. Besonders die These, unser Verhalten sei vollständig durch neuronale Prozesse bestimmt und es gebe für einen freien Willen daher in einem naturwissenschaftlichen Weltbild keinen Platz, wird von vielen Philosophen bestritten. Sie versuchen dagegen aufzuzeigen, weshalb der freie Wille durchaus mit den Erkenntnissen der Hirnforschung vereinbar sei. Doch damit können sie viele Neurowissenschaftler nicht überzeugen. Die Philosophieprofessorin Brigitte Falkenburg von der TU Dortmund fährt eine ganz andere Strategie: Anstatt für eine Vereinbarkeit von Freiheit und neuronalem Determinismus zu argumentieren, hinterfragt sie die Grundannahme, dass die Abläufe im Gehirn deterministisch ablaufen. Nach ihrer Analyse beruhen die Argumente der Neurowissenschaftler gegen den freien Willen auf der Annahme, jedes neuronale Geschehen sei strikt durch das Verhältnis von Ursache und Wirkung festgelegt. Ein solcher Determinismus stehe jedoch im Widerspruch zu zwei weiteren Grundannahmen über den menschlichen Geist, nämlich dass geistige Phänomene von physikalischen zu trennen sind und diese sogar verursachen können.
Mehr: www.gehirn-und-geist.de.
VD: CF