Viele Märtyrer bezeugten trotz entsetzlicher Qualen ihren Glauben
Berthold Seewald beschreibt für DIE WELT die schweren Christenverfolgungen unter Kaiser Diokletian im Februar 303:
Diokletian gab daraufhin alle Zurückhaltung auf und setzte eine reichsweite Verfolgung in Gang. Diese wurde von den Beamten vor Ort allerdings mit unterschiedlichem Engagement durchgeführt. Während Galerius (auf dem Balkan) und Maximian (Italien, Spanien, Nordafrika) sich dabei hervortaten, scheint sich Constantius (Gallien, Britannien) auf die Zerstörung von Kirchen beschränkt zu haben.
Christen, die dem Kaiser opferten, blieben verschont. Aber viele Märtyrer bezeugten ihren Glauben durch bewundernswerte Leidensfähigkeit. Von einem Sklaven wird berichtet, dass man ihn zunächst nackt auszog, in die Höhe zog und auspeitschte. Sodann träufelte man ihm Essig und Salz in die Wunden und röstete ihn langsam auf einem Rost, berichtet der Kirchenhistoriker Wolfram Kinzig.
Vor allem im Osten des Reiches wurden die Edikte ab 303 mit großer Konsequenz durchgesetzt. Kinzig zitiert den christlichen Historiker Eusebius von Caesarea, von dem eine nach Regionen geordnete Liste von Folter- und Hinrichtungsarten überliefert ist: In Arabia bevorzugte man die Hinrichtung mit dem Beil, in Kappadokien das Brechen der Beinknochen. In Mesopotamien wurden die Verurteilten den Kopf voran über schwelendes Feuer gehängt und starben an Rauchvergiftung. In Alexandria schnitt man ihnen Nasen, Ohren, Hände und andere Körperteile ab. In Antiochia wurden sie geröstet, gezwungen, einen Arm ins Feuer zu halten, oder im Meer ertränkt.
Gefürchtet war der Tod auf dem Streckpferd, der mit eisernen oder glühenden Krallen herbeigeführt wurde. Kämpfe mit wilden Tieren oder verschiedene Arten von Feuerhinrichtungen – auf dem eisernen Stuhl oder am Pfahl – erfreuten sich beim paganen Publikum großer Beliebtheit. Um in der Arena für spektakuläre Auftritte zu sorgen, ließen Ausrichter ihrer morbiden Fantasie freien Lauf. Frauen blieben manchmal am Leben, um ins Bordell gesteckt zu werden. In Ägypten ließ ein Statthalter den Christen mit Scherben die Haut aufreißen. Frauen wurden nackt kopfüber an einem Bein aufgehängt und in die Luft gezogen. Andere Verurteilte zerriss man zwischen auseinander schnellenden Bäumen.
Doch derartige Spektakelmartyrien waren ambivalent. Zum einen schreckten sie ab, zum anderen wirkten Standhaftigkeit und der Mut vieler Christen angesichts von Leiden und Tod auch anziehend, „denn sie dokumentierten die Wirkkraft der neuen Religion auf das gläubige Individuum und dessen Hoffnung auf Belohnung im Jenseits“, schreibt Kinzig.
Mehr: www.welt.de.
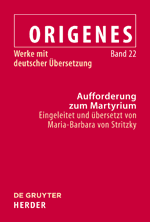 Rezension zum Buch:
Rezension zum Buch: