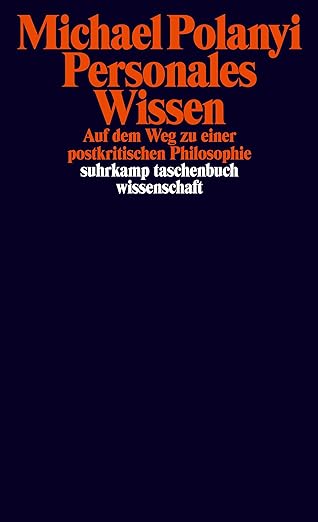Die Lehre vom Zweifel
Michael Polany bläst hier in das gleich Horn wie Alvin Plantinga (Personales Wissen: Auf dem Weg zu einer postkritischen Philosophie, 2023, S. 445–446):
Mein Entschluss, meine Grundüberzeugungen mit philosophischen Mitteln zu bekunden, muss erst noch in ganzheitlicher Form dargelegt werden. Doch zunächst müssen wir uns von einem Vorurteil befreien, das sonst die Moral unseres ganzen Unterfangens untergräbt.
Während der gesamten kritischen Periode der Philosophie galt es als selbstverständlich, dass die Bejahung unbewiesener Überzeugungen die bequeme Straße in Richtung Finsternis darstellt, während man sich der Wahrheit auf dem geraden und engen Pfad des Zweifels nähert. Es wurde die Warnung ausgesprochen, dass uns seit frühester Kindheit eine Vielzahl unbewiesener Überzeugungen eingeflößt worden sei. Religiöse Dogmen, die Autorität der antiken Denker, die Lehren der Scholastiker, die Sprüche der Kinderstube – sie alle formten zusammen ein Korpus von Überlieferungen, die wir nur deshalb zu akzeptieren geneigt seien, weil diese Überzeugungen vorher schon von anderen vertreten worden waren, die wollten, dass wir sie auch unsererseits übernähmen. Wir wurden dazu angehalten, uns gegen den Druck dieser traditionsgebundenen Indoktrinierung zu wehren, indem wir das Prinzip des philosophischen Zweifels dagegen in Stellung brächten. Descartes erklärte, der universelle Zweifel solle seinen Geist von allen Meinungen säubern, die bloß auf Treu und Glauben angenommen worden waren, um ihn der fest in der Vernunft wurzelnden Erkenntnis zu öffnen. In seinen strikteren Formulierungen verbietet uns das Prinzip des Zweifels, überhaupt etwas glauben zu wollen, und es verlangt, dass wir den Geist lieber leer lassen sollen, als zu gestatten, dass Überzeugungen von ihm Besitz ergreifen, die nicht unwiderleglich sind. In der Mathematik, sagt Kant, gibt es keinen Platz für bloßes Meinen, sondern nur für echtes Wissen: »man muss wissen, oder sich alles Urteilens enthalten.«
Die Methode des Zweifels ist eine logische Folge des Objektivismus. Sie verlässt sich darauf, dass die Ausmerzung aller willensgebundenen Komponenten des Glaubens einen Wissensrest übrig lässt, der zur Gänze von objektiven Belegen bestimmt wird. Auf diese Methode hat sich das kritische Denken uneingeschränkt verlassen, um Irrtümer zu vermeiden und die Wahrheit zu erhärten.
Nun möchte ich keineswegs behaupten, dass diese Methode während der Periode des kritischen Denkens immer oder überhaupt irgendwann einmal in strenger Form angewandt worden ist (das ist ja nach meiner Überzeugung unmöglich). Vielmehr möchte ich bloß sagen, dass man sich emphatisch zu ihrer Anwendung bekannt hat, während man sich nur unauffällig und nebenbei dafür ausgesprochen hat, sie zu lockern. Zugegeben, Hume war in dieser Hinsicht ziemlich freimütig. An den Stellen, wo er den Schlussfolgerungen der eigenen Skepsis nicht aufrichtig Folge leisten zu können meinte, beschloss er unverhohlen, sie beiseitezuschieben. Dennoch unterließ auch er es einzuräumen, dass er damit seine eigenen persönlichen Überzeugungen zum Ausdruck brachte. Ebenso wenig hat er sein Recht in Anspruch genommen und seine Pflicht angenommen, sich zu diesen Überzeugungen zu bekennen, sobald dies darauf hinauslief, Zweifel zu ersticken und die strikte Objektivität fallenzulassen. Seine Abweichungen von der Skepsis blieben streng genommen inoffiziell und gehörten nicht in expliziter Form zu seiner Philosophie. Kant hingegen nahm diesen Widerspruch ernst. Er unternahm die übermenschliche Anstrengung, sich der durch Humes Erkenntniskritik sichtbar gewordenen Situation zu stellen, ohne eine Lockerung des Zweifelsprinzips zuzulassen. Im Hinblick auf diese Schwierigkeiten schreibt Kant: »Der Keim der Anfechtungen, der in der Natur der Menschenvernunft liegt, muß ausgerottet werden; wie können wir ihn aber ausrotten, wenn wir ihm nicht Freiheit, ja selbst Nahrung geben, Kraut auszuschießen, um sich dadurch zu entdecken, und es nachher mit der Wurzel zu vertilgen? Sinnet demnach selbst auf Einwütfe, auf die noch kein Gegner gefallen ist, und leihet ihm sogar Waffen, oder räumt ihm den günstigsten Platz ein, den er sich nur wünschen kann. Es ist hiebei gar nichts zu furchten, wohl aber zu hoffen, nämlich, daß ihr euch einen in alle Zukunft niemals mehr anzufechtenden Besitz verschaffen werdet.«
Schon seit Langem hat sich gezeigt, dass Kants Hoffnungen auf ein unbestreitbares Reich der Vernunft zu hoch gegriffen sind. Aber die Leidenschaft des Zweifelns ist auch heute noch spürbar.