Göttlicher Plan und menschliche Freiheit
Die nachfolgende Rezension zu dem Buch:
- Luis de Molina. Göttlicher Plan und menschliche Freiheit. Concordia: Dispuation 52. Latein – Deutsch. Eingeleitet, übersetzt und kommentiert von Christoph Jäger, Hans Kraml und Gerhard Leibold. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 2018. ISBN: 978-3-7873-3023-2, 284 S. € 48,00
erschien in der Zeitschrift GLAUBEN UND DENKEN HEUTE 1/2019 (Nr. 23), S. 74–77):
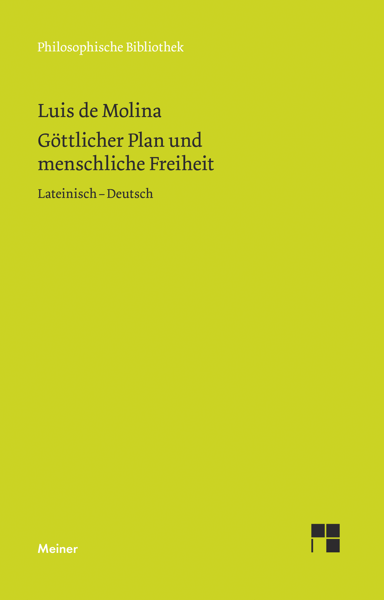 Der jesuitische Philosoph, Theologe und Rechtstheoretiker Luis de Molina (1535–1600) war einer der einflussreichsten und kontroversesten Denker des 16. Jahrhunderts. Sein Studium wurde von der Auseinandersetzung mit Aristoteles und Thomas von Aquin bestimmt. (1) Molina lehrte nach seinem Studium in den portugiesischen Städten Coimbra und Évora. 1571 wurde er zum Doktor der Theologie promoviert. In der erst 1559 gegründeten Universität von Évora entwickelte er sich schnell zu einer akademischen Leitfigur und erwarb sich „in Europa den Ruf eines führenden zeitgenössischen Religionsphilosophen und Theologen“ (S. XIV).
Der jesuitische Philosoph, Theologe und Rechtstheoretiker Luis de Molina (1535–1600) war einer der einflussreichsten und kontroversesten Denker des 16. Jahrhunderts. Sein Studium wurde von der Auseinandersetzung mit Aristoteles und Thomas von Aquin bestimmt. (1) Molina lehrte nach seinem Studium in den portugiesischen Städten Coimbra und Évora. 1571 wurde er zum Doktor der Theologie promoviert. In der erst 1559 gegründeten Universität von Évora entwickelte er sich schnell zu einer akademischen Leitfigur und erwarb sich „in Europa den Ruf eines führenden zeitgenössischen Religionsphilosophen und Theologen“ (S. XIV).
Ab 1583 bereitete Molina den Druck eines Kommentars zu den Fragen 1–74 des ersten Teils der Summa Theologiae von Thomas von Aquin vor. Aus diesem Kommentar entstand schließlich sein religionsphilosophisches Hauptwerk Liberi Arbitrii cum Gratiae Donis, Divina Praescientia, Providentia, Praedestinatione et Reprobatione Concordia, das kurz Concordia genannt wird (der Kommentar zur Summa erschien erst 1592). Die Ausarbeitung erschien nach heftigsten innerkirchlichen Kontroversen erstmals 1588 in Lissabon und in einer überarbeiteten Fassung 1595 in Antwerpen. Nun liegt die zentrale Disputation 52 unter dem Titel Göttlicher Plan und menschliche Freiheit in einer lateinisch-deutschen Ausgabe mit ausführlicher Einleitung und umfangreichem Kommentar vor.
Unter seinen Anhängern wie Gegnern gilt Molinas Konzept bis heute als einer der geistreichsten Versuche zum Thema Willensfreiheit, die in der Geschichte der Philosophie und Theologie formuliert wurden. Allerdings löste er von Anfang an erbitterte philosophische und theologische Dispute aus. Sie erreichten ihren Gipfelpunkt in dem berühmten Gnadenstreit zwischen 1597 und 1607, der mit seiner Zuspitzung der Frage nach der Existenz und Reichweite menschlicher Handlungs- und Entscheidungsfreiheit eine gewichtige Rolle beim Übergang in die Neuzeit spielte.
Im Wesentlichen geht es darum, ob das Verhältnis zwischen einer libertarischen Theorie menschlicher Willens- bzw. Entscheidungsfreiheit auf der einen Seite und unfehlbarer göttlicher Vorsehung und Allwissenheit auf der anderen Seite widerspruchsfrei gedacht werden kann. Libertarische Freiheitskonzepte gehen davon aus, dass die Freiheit einer Handlung mit einer Determiniertheit durch Quellen, die außerhalb des Agierenden liegen und von diesem nicht kontrolliert werden können, unvereinbar ist. Behauptet wird also, dass zumindest für etliche Handlungen von Personen Freiheit gegeben ist. Das Konzil von Trient (1545–1563) hatte etwa in seinem Dekret zur Rechtfertigung festgelegt, dass menschliche Geschöpfe Entscheidungsfreiheit besitzen und sich Gott aus freien Stücken zuwenden. In Kan. 3 heißt es entsprechend: „Wer sagt, der von Gott bewegte und erweckte freie Wille des Menschen wirke durch seine Zustimmung zu der Erweckung und dem Ruf Gottes nichts dazu mit, sich auf den Empfang der Rechtfertigungsgnade zuzurüsten und vorzubereiten, und er könne nicht widersprechen, wenn er wollte, sondern tue wie etwas Lebloses überhaupt nichts und verhalte sich rein passiv, der sei mit dem Anathema belegt“ (DH 1554, vgl. 1525). Aber wie soll so eine libertarische Freiheit mit göttlicher Vorsehung und Allwissenheit harmonisiert werden? Vorherwissen des Zukünftigen setzt die Entscheidungsfreiheit außer Kraft. Also können Entscheidungsfreiheit und Vorherwissen Gottes hinsichtlich des kontingenten Zukünftigen nicht zusammen bestehen. Wenn Gott die Entscheidungen der Menschen nicht ordnet (und so von ihnen wissen kann), muss er ein Wissen über das konditional Zukünftige haben, d. h. ein Wissen, wie der Mensch sich unter verschiedenen Bedingungen verhalten würde. Molina nannte dieses Wissen das Mittlere Wissen (scientia media) und glaubte, damit den Raum zwischen dem rein Möglichen und dem Zukünftigen gefunden zu haben. (2)
Die Herausgeber des rezensierten Bandes schreiben:
„Molinas Grundidee lautet, dass Gott durch jenes Mittlere Wissen bereits in der Schöpfungssituation, d. h., explanatorisch betrachtet, noch ehe eine bestimmte mögliche Welt zur aktualen geworden ist, von jedem auch nur möglichen freien menschlichen Wesen weiß, für welche Handlung es sich in jeder möglichen Entscheidungssituation, in der es sich in einer bestimmten Welt vorfinden könnte, aus freien Stücken entscheiden würde. Unter anderem im Rückgriff auf dieses Wissen, sagt Molina, entscheide Gott sich für die Aktualisierung einer bestimmten möglichen Welt. Da somit alles, was dann dort geschieht, einschließlich freier kreatürlicher Handlungen und Entscheidungen, in letzter Instanz vollständig vom göttlichen Willen abhängt, bleibt Molina zufolge Gott die absolut souveräne causa prima allen Geschehens. Insofern hängen alle Wirkungen der Vorsehung in der Welt von Gottes freiem Willen ab. Gleichwohl bleiben zumindest viele menschliche Handlungen frei, da sie weder kausal durch Naturvorgänge noch durch göttliches Eingreifen, göttliche Vorsehung oder göttliches Vorauswissen determiniert sind.“
Schauen wir uns genauer an, wie Molina die Spannung zwischen der Souveränität Gottes und der Freiheit des Menschen aufzulösen versucht. In Abschnitt 52.9 führt er zunächst seine berühmt gewordene Unterscheidung zwischen drei Arten göttlichen Wissens ein (Hervorhebungen von mir).
„9. Für uns gilt es, drei Arten von Wissen in Gott zu unterscheiden, wenn wir bei dem Versuch, unsere Entscheidungsfreiheit und die Kontingenz der Dinge mit dem göttlichen Vorherwissen zu versöhnen, vermeiden wollen, gefährlich irrezugehen.
Eine Art ist das rein Natürliche Wissen, das als solches auf keine Weise anders in Gott hat sein können. Durch dieses Wissen kennt er all das, worauf sich die göttliche Macht unmittelbar oder unter Mitwirkung von Zweitursachen erstreckt, und zwar sowohl hinsichtlich der Naturen der Einzeldinge und der notwendigen Zusammensetzungen aus ihnen als auch hinsichtlich ihrer kontingenten Zusammensetzungen. Dabei weiß er nicht etwa, dass die letztgenannten in festgelegter Weise zukünftig vorkommen oder nicht vorkommen würden, sondern er weiß, dass sie gleichermaßen vorkommen oder nicht vorkommen konnten, was ihnen notwendigerweise zukommt und daher ebenfalls unter das Natürliche Wissen Gottes fällt.
Die zweite Art ist das rein Freie Wissen, durch das Gott nach dem freien Akt seines Willens ohne irgendeine Voraussetzung und Bedingung absolut und in festgelegter Weise weiß, welche von allen kontingenten Zusammensetzungen tatsächlich künftig vorkommen werden und welche nicht.
Die dritte Art schließlich ist das Mittlere Wissen, durch das Gott in seinem eigenen Wesen kraft des höchsten und unerforschlichen Erfassens eines jeden freien Entscheidungsvermögens unmittelbar erkennt, was es aus seiner angeborenen Freiheit heraus tun würde, wenn es sich in dieser oder in jener oder auch in unendlich vielen Ordnungen der Dinge befände, auch wenn es tatsächlich das Gegenteil tun könnte, falls es wollte, wie aus dem in den Abhandlungen 49 und 50 Gesagten klar hervorgeht.“ (S. 11–13)
Das Natürliche Wissen (scientia naturalis) bezieht sich auf metaphysisch notwendige Sachverhalte. Durch dieses Wissen kennt Gott alles, worauf sich seine Macht unmittelbar oder mittelbar durch die Mitwirkung von Zweitursachen bezieht (vgl. S. 144). Das Freie Wissen (scientia libera) liegt erst dann vor, wenn Gott durch einen Willensakt eine bestimmte Welt aktualisiert hat. Es umfasst alles, was in der Zukunft der Schöpfung tatsächlich passieren wird. „Im Hinblick auf Molinas atemporalistische Konzeption göttlicher Ewigkeit ist dabei zu beachten, dass Gottes Freies Wissen als seinem kreativen Willensakt nicht etwa zeitlich, sondern logisch oder explanatorisch nachgeordnet gedacht werden muss“ (S. 145). Das Natürliche Wissen ist schon da, bevor Gott etwas schafft. Das Freie Wissen besitzt Gott erst, nachdem er etwas geschaffen hat. Das Mittlere Wissen bedeutet, dass Gott schon vor dem Schöpfungsakt von jedem möglichen freien menschenlichen Wesen weiß, für welche Handlungen es sich in jeder kontingenten Entscheidungssituation entscheiden würde. Gott beschließt demzufolge aufgrund des Natürlichen und des Mittleren Wissens die Aktualisierung einer bestimmten möglichen Welt. Alles, was dann realisiert wird, hänge damit vom souveränen Willen Gottes ab und sichere zugleich freie menschliche Handlungen.
Im folgenden Abschnitt erörtert Molinas die Beziehungen von mittlerem Wissen (lat. scientia media) zum Freien und Natürlichen Wissen. Mittleres Wissen ist keine Spielart von Freiem Wissen, denn es liegt prävolitional (also noch nicht durch den Willen bestimmt, d. h. explanatorisch) vor dem Schöpfungsakt vor, was ja für Freies Wissen nicht gilt. Außerdem unterliegt das, was Gott durch dieses Wissen weiß, nicht seiner Macht. Das gilt für Freies Wissen ebenfalls nicht. Denn hätte sich Gott für die Aktualisierung anderer freier Geschöpfe entschieden, wäre sein Freies Wissen darüber, was in der Welt geschieht oder geschehen wird, ein anderes (vgl. S. 148). Die Herausgeber schreiben:
„Mittleres Wissen ist aber auch kein Natürliches Wissen, denn dieses hätte nicht anders ausfallen können; es gibt für Molina keine mögliche Welt, in der Gottes Wissen hinsichtlich des Notwendigen ein anderes ist als das, was er faktisch besitzt. Gottes Mittleres Wissen hingegen umfasst freie geschöpfliche Handlungen und Entscheidungen, und da freies Handeln für Molina bedeutet, dass seine Subjekte auch anders handeln und entscheiden könnten, könnte auch Gottes Mittleres Wissen ein anderes sein. Das Mittlere Wissen hängt somit nicht allein von Gottes Natur, sondern wesentlich auch von den möglichen Geschöpfen ab, auf die es sich bezieht. Insofern das Mittlere Wissen bereits vor dem Schöpfungsakt in Gott vorliegt, teilt es gleichwohl eine Eigenschaft mit dem Natürlichen Wissen, die aber das Freie Wissen nicht hat. Und insofern es sich auf kontingente Inhalte bezieht, teilt es eine Eigenschaft mit dem Freien Wissen, die das Natürliche Wissen nicht hat. Insofern ist es ein Mittleres zwischen diesen beiden anderen Wissensformen“ (S. 148)
Schon zu Molinas Zeiten war es schwer, zu verstehen, was genau mit dem Mittleren Wissen gemeint ist. Deshalb hat sich der Theologe bemüht, durch weitere Erklärungen Missverständnisse auszuräumen. Er erläutert das Mittlere Wissen folgendermaßen:
„Damit dich aber diese Lehre auf den ersten Blick nicht verwirre, bedenke, dass alle folgenden Sätze ganz offensichtlich miteinander übereinstimmen und zusammenhängen: (i) Nichts ist in der Macht des Geschöpfes, was nicht auch in Gottes Macht ist. (ii) Gott in seiner Allmacht kann unsere freie Entscheidung lenken, wohin er will, außer zur Sünde; dieses nämlich impliziert einen Widerspruch, wie in Abhandlung 31 gezeigt wurde, (iii) Was immer Gott unter Hinzutritt einer Zweitursache bewirkt, kann er auch aus sich allein bewirken, es sei denn, die Wirkung beinhaltet, dass sie von einer Zweitursache stammt, (iv) Gott kann Sünden zulassen, aber nicht anordnen oder zu ihnen anregen oder eine Neigung zu ihnen hervorrufen. (v) Ebenso gilt: Die Tatsache, dass ein mit freiem Entscheidungsvermögen ausgestattetes Wesen sich entweder zur einen oder zur anderen Seite wendet, wenn es sich in einer bestimmten Ordnung von Dingen und Umständen befindet, geht nicht auf Gottes Vorherwissen zurück. Vielmehr weiß Gott dies deshalb vorher, weil es zu einem mit freiem Entscheidungsvermögen ausgestatteten Wesen gehört, eben dies selbst frei zu tun. Jene Tatsache geht auch nicht darauf zurück, dass Gott will, dass sie von diesem Wesen so herbeigeführt wird, sondern darauf, dass es selbst dies frei tun will.
Daraus folgt mit größter Klarheit: Das Wissen, durch das Gott vorhersieht, was ein mit freiem Entscheidungsvermögen ausgestattetes Wesen unter der Voraussetzung tun wird, dass es sich in einer bestimmten Ordnung der Dinge befindet, bevor er beschließt, es zu erschaffen, hängt davon ab, dass jenes Wesen selbst aufgrund seiner Freiheit das eine oder etwas anderes tun wird, und nicht umgekehrt. Das Wissen hingegen, durch das Gott unabhängig von irgendeiner Voraussetzung absolut weiß, was durch die Betätigung von einem geschaffenen freien Entscheidungsvermögen tatsächlich geschehen wird, ist in Gott immer Freies Wissen und hängt von der freien Festlegung seines Willens ab, durch die er ein solches freies Entscheidungsvermögen in einer solchen oder einer anderen Ordnung der Dinge zu erschaffen beschließt.“ (S. 16–17)
Die mit dieser Auffassung angesprochenen Fragen weisen weit über ihren historischen Kontext hinaus. Sie sind bis heute aktuell und berühren Freiheitskonzepte, Handlungstheorien, Kausalitätstheorien, Metaphysik oder auch die Gotteslehre. Innerhalb der Theologie hat sich neben Ansätzen, die die Freiheit Gottes betonen (vgl. reformiertes Lager) und jenen, die die Freiheit des Menschen herausheben (vgl. arminianisches Lager bis hin zum Open Theism) der Molinismus sogar im evangelikalen Raum als vermittelnde Position etablieren können. Ein bekannter christlicher Religionsphilosoph, der den Molinismus in unseren Tagen verteidigt, ist William Lane Craig. (3)
Noch heute disputieren Anhänger und Gegner über das Mittlere Wissen. Christoph Jäger skizziert in diesem Band gewichtige Einwände gegen Molinas Theorie sowie mögliche Erwiderungen (S. CXXXVII–CLXXVI); sogar einige von Molina in Anschlag gebrachte biblische Begründungstexte werden verhandelt. Erläutert wird ebenfalls der Einwand, der aus der Sicht thomistischer und reformierter Theologie besonders denkwürdig ist. Er lautet: Gottes Mittleres Wissen ist mit seiner uneingeschränkten Souveränität unvereinbar. Gottes Einfachheit fordert nämlich, dass sein Wissen nicht durch etwas ihm Extrinsisches oder durch etwas, das nicht durch ihn selbst verursacht ist, bestimmt werden kann. Der Molinismus macht aber nun Gott von etwas anderem abhängig und so ist er in seinem Wissen passiv und nicht mehr actus purus (vgl. S. CXLIV–CXLV). Molina besteht darauf, dass göttliches Wissen in bestimmter Weise darauf beruht, was freie Geschöpfe in bestimmten Umständen tun würden. Zwar versucht er, Gott so darzustellen, als bleibe er die erste Ursache allen weltlichen Geschehens. Die Freiheit seiner Entscheidungen scheint aber letztlich doch von dem abhängig zu sein, was kreatürliche Akteure tun, falls sie tatsächlich aus freien Stücken heraus handeln. Der Molinismus stellt demnach Gottes Aseität, seine absolute Unabhängigkeit, infrage. (4)
Wie beim Meiner Verlag üblich, ist der Druck ausgezeichnet umgesetzt worden. Ein Index hilft bei Erschließen des Werkes. Die Herausgeber haben mit der lateinisch-deutschen Ausgabe der Disputation 52 einschließlich der ausführlichen Einleitung und des vorzüglichen Kommentars eine bemerkenswerte Arbeit geleistet. Ihnen, der Universität Münster, an der dieses Buch entstanden ist, und dem Meiner-Verlag, ist für die Verwirklichung dieses Projektes sehr zu danken.
Fußnoten:
- Allerdings beschäftigte sich Molina ebenfalls mit Martin Luther und Johannes Calvin. Er meinte, die Vorstellung, Gnade sei eine Art göttliche Substanz, die die Menschen befähige, gute Werke zu vollbringen, sei falsch. Sein Biograph Kirk MacGregor schreibt (Luis de Molina. Grand Rapids (Michigan): Zondervan Academic, 2015, S. 18): „Stattdessen stimmte Molina mit Luther und Calvin überein, die Gnade als Gottes unverdiente Gunst gegenüber sündigen Menschen und Gottes unverdiente Hilfe bei der Sicherung ihrer Wiedergeburt und Heiligung zu verstehen. Aber im Gegensatz zu Luther und Calvin bekräftigte Molina, dass Gott jedem Menschen, den er erschaffen hat, ausreichend Gnade für seine Rettung schenkt. Er begründete das mit biblischen Texten wie 1. Timotheus 2,4 (‚[Gott unser Retter] will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen‘) und 2. Petrus 3,9 (‚der Herr hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde.‘).
- Reinhold Seeberg schreibt über Molinas Entwurf (Lehrbuch der Dogmengeschichte, Zweite Hälfte, 1895, S. 442–443): „Der Mensch ist auch als Sünder frei, nicht blos zu natürlichen, sondern auch zu übernatürlichen Handlungen, vorausgesetzt die Mitwirkung der Gnade. Die Gnade erhebt und beschwingt die Seele, sie macht sie fähig zum Übernatürlichen, aber der eigentliche Akt der Entscheidung wird nicht von der Gnade im Willen bewirkt, sondern der Wille vollzieht ihn selbst und zwar in Verbindung mit der Gnade. Wie also der freie Willensentschluß und die Befähigung der Seele zum Übernatürlichen (Gnade) in ihrer Cooperanz den wirklichen Anfang des Heilsstandes bezeichnen, so bringen beide fortdauernd concursu simultaneo die übernatürlichen Akte hervor. Sie wirken zusammen wie zwei Männer, die an einem Seil ein Schiff ziehen. Nun würde aber die hierdurch erzielte, durchgehende Cooperanz hinfällig, wenn wirklich alle freien Akte der Geschöpfe, wie die Thomisten wollen, von Gott in sich als von ihm selbst gewollt erkannt werden. Hier kommt Mol. der Begriff der scientia media zu Hilfe. Gott sieht nämlich von den freien Geschöpfen voraus, was sie unter Eintritt bestimmter Bedingungen tun oder nicht tun werden. Die scientia media ist also die Erkenntnis des Bedingt-Zukünftigen. Vermöge derselben erschaut Gott das künftige Weltbild und gestaltet die Weltordnung.“
- Siehe besonders: William Lane Craig. Divine Foreknowledge and Human Freedom: The Coherence of Theism – Omniscience. Leiden: Brill, 1991.
- Siehe zur Einfachheit Gottes: Steven J. Duby. Divine Simplicity: A Dogmatic Account. London, New York, Oxford u. a.: t & t Clark, 2017, bes. S. 118–132. Reziprok deutet übrigens James N. Anderson die Probleme des Molinismus. Er spricht von einem determinierenden Indeterminismus, da eben Gott durch die äußeren Umstände die Entscheidungen des Akteurs letztlich doch prädisponiere. Siehe dazu: URL: https://www.proginosko.com/2014/01/the-fallible-god-of-molinism und URL: https://www.proginosko.com/2014/05/a-brief-response-to-william-lane-craig-on-molinism (Stand: 30.04.2019). Eine gute Darstellung der reformierten Entgegnungen auf den Molinismus ist zu finden in: Richard A. Muller. Post-Reformation Reformed Dogmatics. Bd. 3. Grand Rapids (Michigan): Baker Academics, 2003, S. 417–432.