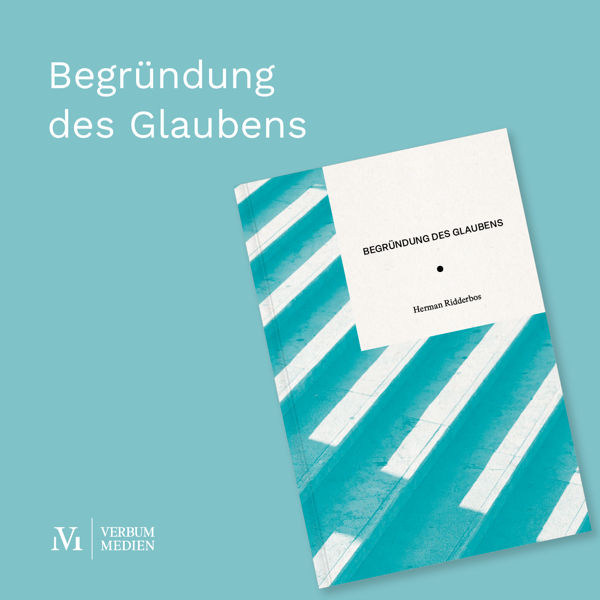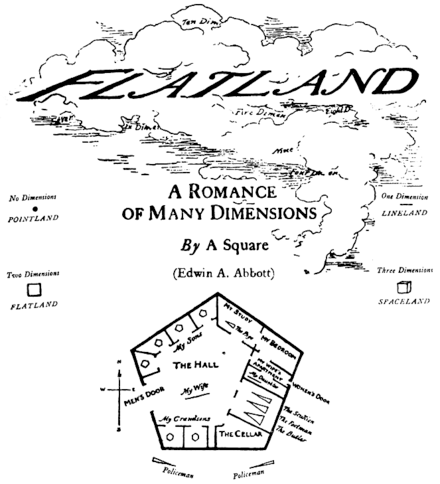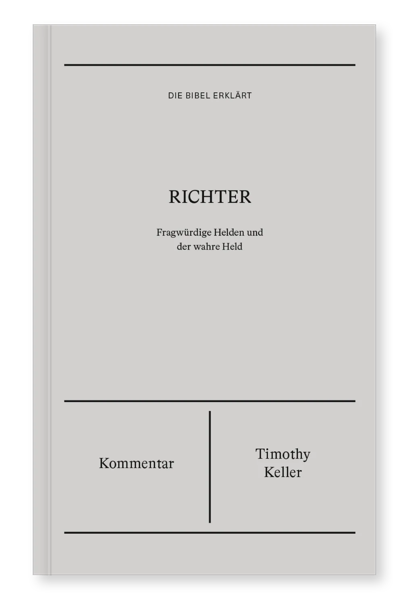Der Europäer große Schuldlust
Die Kritik postkolonialer Theoretiker am westlichen Kolonialismus blendet den langen Strang imperialer Geschichte gewöhnlich aus. Daraus entstehen verzerrte Geschichtsbilder, die neue Machtgelüste bedienen, meint Heiko Heinisch in seinem Gastbeitrag für die FAZ. Der Historiker schreibt darin:
In Werken postkolonialer Theorie, nicht zu verwechseln mit historischer Forschung zur Kolonialgeschichte, ist heute indessen eine manische Fixiertheit auf Europa augenfällig, ein Eurozentrismus, der den langen Strang imperialer Geschichte der Menschheit ausblendet. In dieser Darstellung wird Europa zum alleinigen Subjekt der Geschichte, während alle anderen Völker und Regionen zu bloßen Objekten europäischen Handelns degradiert werden. Genährt wird eine Weltsicht, die von der Annahme ausgeht, alle Übel dieser Welt – Kolonialismus, Imperialismus, Rassismus, Sklaverei, Sexismus, ja jegliche Form von Unterdrückung und Ausbeutung – seien erst durch den Westen und das „westliche Denken“ erzeugt worden, gemäß der leitenden Annahme, der europäische Kolonialismus wirke bis heute fort und halte die Völker der Welt in Knechtschaft.
So schreibt etwa Achille Mbembe, einer der Stars der postkolonialen Theorie, in seinem Buch „On the Postcolony“, es gebe für afrikanische Gesellschaften seit dem fünfzehnten Jahrhundert keine „distinktive Geschichtlichkeit“ mehr, die nicht von europäischer Vorherrschaft geprägt sei. Keine Erwähnung findet, dass bereits vor dem fünfzehnten Jahrhundert außerafrikanische Mächte die Entwicklung Afrikas maßgeblich prägten: seit dem siebten Jahrhundert die arabischen, später die osmanischen Eroberer. An anderer Stelle beschreibt Mbembe den Monotheismus als Ursache von Eroberungen. Es geht allein um das Christentum, das, so Mbembe, auf der Vorstellung der Weltherrschaft „sowohl in der Zeit als auch im Raum“ basiere, sich das Eigentumsrecht auf die ganze Welt zugeschrieben und daraus das Recht auf Eroberung abgeleitet habe. In diesem Kontext, so folgert er, müssten die Kreuzzüge neu interpretiert werden.
…
Das Geschichtsbild maßgeblicher Vertreter postkolonialer Theorien, das einem Aktivismus den Boden bereitet, an dessen Ende der Westen selbst und damit der Weg der Aufklärung und Demokratisierung europäischer Gesellschaften abgewickelt werden soll, ist übrigens ganz im Sinne jener Mächte, die, wie Russland, China oder die Türkei die eigene Geschichte verklären und ihren weltpolitischen Aufstieg längst eingeleitet haben. Ein Ende des Westens aber wird keine von Gewalt und Krieg befreite Menschheit bedeuten, vielmehr werden ihm Imperien folgen, die mit Grundrechten und Rechtsstaatlichkeit vermutlich wenig anfangen können.
Mehr: www.faz.net. Der dazugehörige Buch Postkoloniale Mythen: Auf den Spuren eines modischen Narrativs von Heiko Heinisch gibt es hier (#ad).