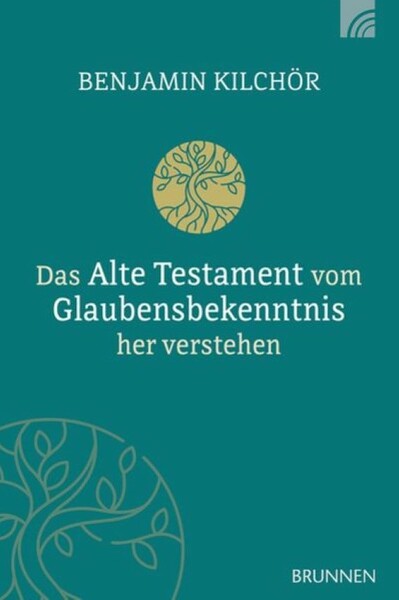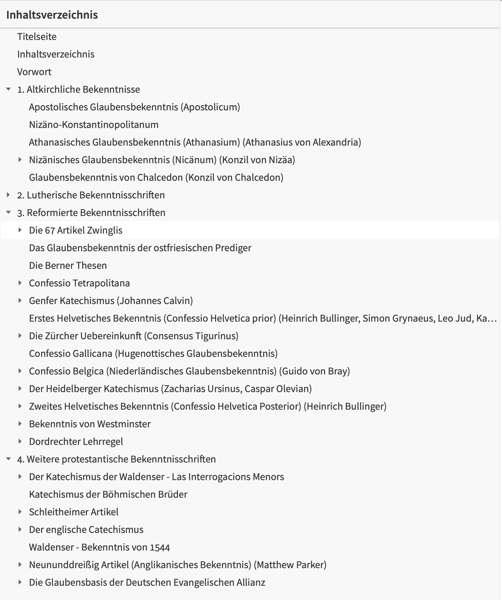Das Erste Londoner Bekenntnis („First London Confession“) von 1644 ist im deutschsprachigen Raum fast in Vergessenheit geraten. Kürzlich wurde eine deutsche Übersetzung vorgelegt. Dazu heißt es:
Das Erste Londoner Bekenntnis existiert historisch in drei in London ab 1644 herausgegebenen Textfassungen (deren letzte weiter nachgedruckt wurde), die hier vorgelegte Übersetzung folgt der aus diesen historischen Fassungen erarbeiteten englischsprachigen Comprehensive Edition (umfassenden oder integrierten Fassung), der im Wesentlichen das Anliegen zugrundeliegt, aus den geschichtlichen Textgestalten diejenige Variante (bei zumeist nur geringen Abweichungen der Formulierung) wiederzugeben, die biblische Aussagen auf die beste und klarste Weise wiedergibt.
Zur theologischen Ausrichtung schreiben die Übersetzer:
Das Erste Londoner Glaubensbekenntnis (1LCF, First London Confession of Faith) gehört – sowohl in seinen drei historischen Textformen als auch in der Bestandteile dieser Ausgaben integrierenden Comprehensive Edition – zu den reformierten Bekenntnissen. Dies wird nicht zuletzt daran erkennbar, welchen Stellenwert es der Gnadenlehre beimisst. Es bezeugt in Artikel 3, dass Gott in seiner Allmacht alles zu seiner Verherrlichung bewirkt. Das beinhaltet vor allen Dingen, dass er einige Menschen zur Errettung in und durch Jesus Christus erwählt hat. Die Errettung von Menschen beruht demnach vollständig auf der göttlichen Gnade. Die Gnadenlehre fügt sich dabei ein in eine Sicht auf Gott, bei der er allein im Mittelpunkt von allem steht. Alles, was Gott bewirkt, tut er zur Verherrlichung seines Namens und zum Wohl seiner Erwählten. Beides wird in Artikel 5 zusammengehalten. Das Wohl der Erwählten besteht nicht zuletzt darin, dass Gott sie allein aus Gnade errettet. Er befreit sie dazu, ihn mit der allergrößten Freude anzubeten und zu preisen (Artikel 6).
In Artikel 8 bekennt sich das 1LCF zur Heiligen Schrift als einziger Richtschnur für Glauben und Gehorsam. Dabei stellt es heraus, welche überragende Bedeutung innerhalb der Heiligen Schrift das Evangelium hat. Die Ablehnung des Evangeliums wird am Ende der Hauptgrund für die Verdammnis der Ungläubigen sein (Artikel 7). Der Glaube wird von Gott durch die Predigt des Evangeliums bewirkt (Artikel 24). Gott stellt durch die Verwendung dieses Mittels sicher, dass der Glaube an Jesus Christus kein menschliches Verdienst ist, sondern Gottes freie Gabe. Bemerkenswert ist die Aussage in Artikel 25, wonach die Verkündigung des Gesetzes nicht nötig ist, um einen Sünder auf die Annahme des Evangeliums vorzubereiten. Christus wird ihm allein durch das Evangelium wirksam als Retter vor Augen gestellt.
Das Herzstück des 1LCF ist die Christologie mit der daraus abgeleiteten Soteriologie (Artikel 9 bis 32): Jesus Christus wird bekannt als der Mittler des neuen Bundes zwischen Gott und den Menschen, der ein ewiger Bund ist (Artikel 10). Er ist in vollkommener Weise für die Gemeinde Gottes der Prophet, der Priester und der König. Als höchster Prophet offenbart Christus seinem Volk die Wahrheit des Evangeliums (Artikel 15). Christus musste wahrer Gott sein, um selber Gottes Wahrheit und Willen vollkommen zu erfassen. Und er musste wahrer Mensch werden, um diese göttliche Wahrheit Menschen zu offenbaren (Artikel 16). Als Priester hat Christus einen wirksamen Sühnetod erlitten, der zur Errettung aller Erwählten führt (Artikel 17 und 21). Als auferstandener Herr ist Christus der König, der seine Gemeinde regiert (Artikel 19). Was er als ihr Prophet und ihr Priester bewirkt hat, wendet er als ihr König ihr zu Gute an. Das hat zur Folge, dass alle Erwählten im Glauben ausharren und zur endgültigen Errettung bewahrt werden.
Der Glaube wird von seiner göttlichen und seiner menschlichen Seite beleuchtet: Er ist eine Gabe Gottes an die Erwählten; und er ist vom Menschen aus gesehen ein herzliches Vertrauen in die Wahrheit, die Gott in Christus offenbart hat (Artikel 22). Wer echten Glauben hat, hält an der Erkenntnis von Christus, vor allem was seine Person und seine Ämter betreffen, fest. Alle, die durch Gottes Gnade diesen Glauben empfangen haben, können nicht endgültig abfallen, sondern Gott bewahrt sie in diesem Glauben, sodass sie am Ende das ewige Leben erlangen (Artikel 23 und 26).
Mehr hier: london1644.info.