 Der reformierte Theologe Cornelius Van Til (1895–1987) gilt als Begründer der sogenannten voraussetzungsbewussten Apologetik (im englischen Sprachraum spricht man von „Presuppositionalism“, ein Begriff, der gelegentlich auch mit „Präsuppositionalismus“ oder „präsuppositionaler Apologetik“ übersetzt wird). Er studierte am Calvin College, dem Princeton Theological Seminary und promovierte 1927 an der Universität Princeton. Da sich das Princeton Theological Seminary nach dem segensreichen Wirken von Charles Hodge (1797–1878) und Benjamin Warfield (1851–1921) Ende der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts für den theologischen Liberalismus öffnete, gründete der Presbyterianer John Gresham Machen (1881–1931) im Jahr 1929 das konservative Westminster Theological Seminary. Dort wurde Cornelius Van Til 1930 als Professor für Apologetik berufen und erst nach über 40-jähriger erfolgreicher Lehrtätigkeit im Jahre 1972 emeritiert.
Der reformierte Theologe Cornelius Van Til (1895–1987) gilt als Begründer der sogenannten voraussetzungsbewussten Apologetik (im englischen Sprachraum spricht man von „Presuppositionalism“, ein Begriff, der gelegentlich auch mit „Präsuppositionalismus“ oder „präsuppositionaler Apologetik“ übersetzt wird). Er studierte am Calvin College, dem Princeton Theological Seminary und promovierte 1927 an der Universität Princeton. Da sich das Princeton Theological Seminary nach dem segensreichen Wirken von Charles Hodge (1797–1878) und Benjamin Warfield (1851–1921) Ende der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts für den theologischen Liberalismus öffnete, gründete der Presbyterianer John Gresham Machen (1881–1931) im Jahr 1929 das konservative Westminster Theological Seminary. Dort wurde Cornelius Van Til 1930 als Professor für Apologetik berufen und erst nach über 40-jähriger erfolgreicher Lehrtätigkeit im Jahre 1972 emeritiert.
Van Til verbrachte sein erstes Lebensjahrzent in den Niederlanden. In diese Zeit fällt das erfolgreiche Wirken des Theologen und Politikers Abraham Kuyper (1837–1920). (A. Kuyper gilt als Begründer des Neo-Calvinismus, gründetet 1880 die Freie Universität in Amsterdam und lehrte dort als Professor Theologie. Von 1901 bis 1905 war er niederländischer Ministerpräsident, siehe dazu auch hier). Nachdem seine Familie nach Nordamerika ausgewandert war, knüpfte Van Til an die akademischen Leistungen der Niederländer A. Kuyper, D. H. Th. Vollenhoven (1892–1978) und H. Dooyeweerd (1894–1977) sowie H. Bavinck (1854–1921) an und entwickelte seine eigene apologetische Vorgehensweise.
Van Til beeinflusste besonders die nordamerikanische Apologetik. Unter den vielen Theologen, die den Ansatz der voraussetzungsbewussten Apologetik übernahmen, sind Greg L. Bahnsen (1948–1995) und John M. Frame (*1939) herauszuheben. Beide haben im Sinne ihres Lehrers apologetisch gearbeitet und eigene Interpretationen seiner Methodologie vorgelegt. Da Frame signifikante Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm und Van Til offenlegte, ist er bei einigen engen „Van Tilianern“ umstritten. Dagegen gilt Bahnsen in diesen Kreisen als treuer Gefolgsmann seines Westminster Lehrers. Auch der Theologe Jay Adams studierte bei Van Til und hat die voraussetzungsbewusste Apologetik in den Bereich der Seelsorgelehre übertragen. Mehrere von Van Tils Studenten sind heute zudem renommierte Apologeten, obwohl sie die Vorgehensweise ihres Lehrers modifizierten oder sogar ablehnten. So avancierte beispielsweise Edward John Carnell (1919–1967) zum Professor für Apologetik am Fuller Seminary in Pasadena (USA). Francis Schaeffer reifte in den evangelikalen Kreisen zum einflussreichsten apologetischen Denker des vergangenen Jahrhunderts. (Van Til war über die Verfremdung und Entschärfung seiner voraussetzungsbewussten Apologetik alles andere als erfreut und verfasste entsprechende Kritiken, die auf der CD-ROM Werkausgabe enthalten sind. Vor Francis Schaeffer hatte Van Til großen Respekt und die Schrift „The Apologetic Methodology Of Francis A. Schaeffer“ wurde zu Lebzeiten des Verfassers nicht publiziert, sondern nur unter den Studenten verteilt. Für weitere Informationen siehe: C. Van Til, The Works of Cornelius Van Til, 1997.)
Schauen wir uns an, was den Ansatz von Van Til gegenüber der klassischen Apologetik auszeichnet:
Van Til war vom traditionellen Ansatz der Apologetik enttäuscht, gelegentlich wird ihm sogar vorgeworfen, die evidentialistische Methode scharf bekämpft zu haben. Dies trifft nur eingeschränkt zu, da für ihn die evidentialistische Apologetik nicht durchweg verwerflich war, sondern lediglich kurz griff. In seinem Buch Common Grace and the Gospel schreibt er:
„Soweit zwischen den beiden Positionen entschieden werden musste, wählte ich die Position von Kuyper anstelle der von Hodge und Warfield. Aber zwei Überlegungen nötigten mich, letztlich die Kombination einiger Elemente aus beiden Positionen zu suchen.“ (C. V. Til, Common Grace and the Gospel, 1995, S. 184.)
Von der so genannten Old Princeton-Schule, für die Charles Hodge und Benjamin Warfield stehen, übernahm Van Til die Auffassung, der christliche Glaube sei vernünftig zu rechtfertigen. Noch fester als sie war er davon überzeugt, dass allein christlicher Glaube intellektuell verantwortbar sei. Van Til nahm auch die von der Old Princeton-Schule behauptete Antithese zwischen christlichem und nicht-christlichem Denken auf, allerdings meinte er, dass diese Antithese von der Old Princeton-Schule im theologischen Denken zwar gut begründet und berücksichtigt, aber nicht konsequent auf die apologetische Arbeitsweise übertragen wurde.
Wie Hodge oder Warfield glaubte Van Til, dass wir Christen uns auf unsere Sinnesorgane, auf die Logik und auf Erfahrungssätze verlassen können, da wir wissen, dass Gott diese Welt schuf und die Sinnesorgane dafür da sind, Orientierung in dieser Welt zu ermöglichen. Aber er kombinierte diesen sogenannten Common Sense-Realismus mit der schärferen „Kuyperianischen Form“ der Antithese (die so genannte Amsterdamer-Schule).
Der Common Sense-Realismus behauptet, dass Nicht-Christen in einer von Gott geschaffenen Welt leben und deshalb auf der Grundlage christlicher Denkvoraussetzungen operieren, ob sie diese nun anerkennen oder nicht. Für die Old Princeton-Schule heißt das, dass Christen viele Denkvoraussetzungen mit den Nicht-Christen teilen. Christen wie Nicht-Christen sind Geschöpfe Gottes und in eine gemeinsame Welt hineingestellt. Auf diesem gemeinsamen Fundament stehend, können nun Argumente für oder gegen die Existenz Gottes vorgetragen werden. Warfield, Hodge oder auch Montgomery sind der Auffassung, dass die Summe der Argumente deutlich dafür spricht, dass Gott da ist.
Van Til war dagegen wie Kuyper überzeugt, dass Nicht-Christen die christlichen Denkvoraussetzungen besonders in den Glaubensfragen unterdrücken und damit die klassischen Argumente für das Dasein Gottes ins Leere laufen. Er behauptete wiederholt, dass es diese gemeinsamen Denkvoraussetzungen oder diesen „neutralen Boden“ nicht gäbe. Der natürliche Mensch revoltiere als Sünder gegen die Wahrheit Gottes und interpretiere deshalb die Wirklichkeit anders als ein Christ. Van Til schreibt:
„Der reformierte Apologet stimmt nicht überein mit der Interpretation des natürlichen Menschen, er selbst [also der natürliche Mensch] sei der letztgültige Bezugspunkt. Er muss daher seinen Anknüpfungspunkt mit dem natürlichen Menschen in dem suchen, was unterhalb der Schwelle seines Bewusstseins liegt, nämlich in dem Sinn für das Göttliche, den er zu unterdrücken sucht. Und um das zu tun, muss der reformierte Apologet auch einen Anknüpfungspunkt suchen mit den Systemen, die vom natürlichen Menschen errichtet wurden. Aber dieser Anknüpfungspunkt muss zu einer Art Frontalzusammenstoß führen. Wenn es keinen Frontalzusammenstoß mit den Systemen des natürlichen Menschen gibt, dann wird es keinen Anknüpfungspunkt an den Sinn für das Göttliche im natürlichen Menschen geben. Das heißt also: Wenn der reformierte Apologet mit dem natürlichen Menschen nicht über das Objekt des Wissens übereinstimmt, darf er mit ihm auch nicht über die Methode übereinstimmen, die angewandt wird, um Wissen zu erlangen. Gemäß der Lehre des reformierten Glaubens sind alle Tatsachen der Natur und der Geschichte das, was sie sind, und tun das, was sie tun, in Übereinstimmung mit dem einen umfassenden Ratschluss Gottes. Alles, was vom Menschen gewusst werden mag, weiß Gott schon. Es wird von Gott bereits gewusst, weil es von ihm kontrolliert wird.“ (C. V. Til, Common Grace and the Gospel, 1995, S. 98–99)
Unsere Denkvoraussetzungen fungieren wie ein Rahmen für unsere Beobachtungen und Überlegungen. Nur wenn die Selbstoffenbarung Gottes unser letzter Bezugsrahmen ist, kann die richtige Interpretation unserer Welt und der geistlichen Wirklichkeiten gelingen.
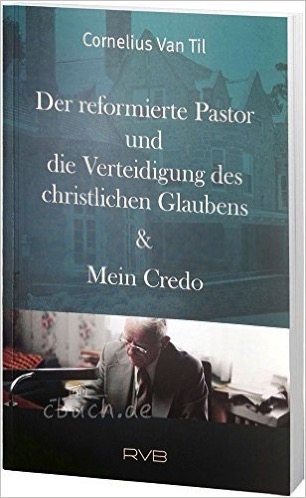 In der deutschen Sprache ist bisher so gut wie nichts von Cornelius Van Til erschienen. Christian Beese hat allerdings nun das Buch Der reformierte Pastor und die Verteidigung des christlichen Glaubens (ein Kapitel aus dem Buch The Reformed Pastor and Modern Thought) herausgegeben. Der Text, der sich mit der katholischen Dogmatik, dem Ökumenismus und dem Protestantismus (einschließlich Kant) befasst, wird durch die berühmte Schrift „Mein Credo“ ergänzt. „Mein Credo“ erschien zuerst im Band Jerusalem and Athens. Der Herausgeber der deutschen Ausgabe schreibt dazu:
In der deutschen Sprache ist bisher so gut wie nichts von Cornelius Van Til erschienen. Christian Beese hat allerdings nun das Buch Der reformierte Pastor und die Verteidigung des christlichen Glaubens (ein Kapitel aus dem Buch The Reformed Pastor and Modern Thought) herausgegeben. Der Text, der sich mit der katholischen Dogmatik, dem Ökumenismus und dem Protestantismus (einschließlich Kant) befasst, wird durch die berühmte Schrift „Mein Credo“ ergänzt. „Mein Credo“ erschien zuerst im Band Jerusalem and Athens. Der Herausgeber der deutschen Ausgabe schreibt dazu:
„Mein Credo“ ist eine einführende, grundlegende Zusammenstellung seiner Gedanken, erschienen in Jerusalem and Athens, Critical Discussions on the Philosophy and Apologetics of Cornelius Van Til. Dieser 500 Seiten starke Band, herausgegeben von E. R. Geehan, ist Dr. Van Til aus Anlass seines 75. Geburtstages und seines 40-jährigen Dienstjubiläums als Professor für Apologetik am Westminster Theological Seminary gewidmet. Zusätzlich zu zwei größeren Essays von Herman Dooyeweerd und Hendrik G. Stoker sind in Jerusalem and Athens Beiträge folgender Autoren enthalten: Berkouwer, Trimp, Packer, Rogers, Zuidema, Jewett, Hughes, Gaffin, Ridderbos, Mekkes, Weaver, Rushdoony, Singer, Lewis, Home, Lane, Knudsen, Montgomery, Pinnock, Reid, Howe und Holmes. Ein Merkmal dieser Festschrift ist, dass Dr. Van Til in den meisten Fällen auf die Beiträge antwortet.
Meine Hoffnung ist, dass diese beiden vergleichsweise kurzen Auszüge sich als eine gute Einführung in das Denken von Cornelius Van Til erweisen werden.

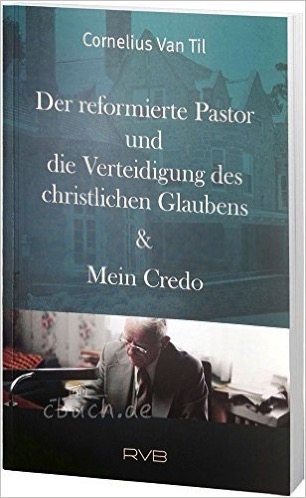 In der deutschen Sprache ist bisher so gut wie nichts von Cornelius Van Til erschienen. Christian Beese hat allerdings nun das Buch
In der deutschen Sprache ist bisher so gut wie nichts von Cornelius Van Til erschienen. Christian Beese hat allerdings nun das Buch