Das Böse, der Teufel und Dämonen
Folgende Rezension erschien zuerst in Glauben und Denken heute (Nr. 20, 11. Jg., 2/2017, S. 63–64):
- Jan Dochhorn, Susanne Rudnig-Zelt u. Benjamin Wold. Das Böse, der Teufel und Dämonen – Evil, the Devil, and Demons. WUNT II 412. Tübingen: Mohr Siebeck, 2016. 84,00 Euro
 Im Zentrum des Sammelbandes steht die Frage nach dem Bösen in den monotheistischen Religionen. Der Schwerpunkt liegt auf dem Judentum und Christentum sowie insbesondere dem Alten Testament als dem Buch, das beide Religionen entscheidend geprägt hat. Berücksichtigt werden aber auch neutestamentliche Passagen, Texte aus Qumran und mittelalterliche Überlieferungen.
Im Zentrum des Sammelbandes steht die Frage nach dem Bösen in den monotheistischen Religionen. Der Schwerpunkt liegt auf dem Judentum und Christentum sowie insbesondere dem Alten Testament als dem Buch, das beide Religionen entscheidend geprägt hat. Berücksichtigt werden aber auch neutestamentliche Passagen, Texte aus Qumran und mittelalterliche Überlieferungen.
Die Beiträge des Bandes zeigen, dass es in den antiken jüdischen und christlichen Traditionen eine Vielfalt von Vorstellungen und Verkörperungen des Bösen gibt. Wir finden etwa das Böse als Dämonen oder den Teufel. Etliche Texte deuten das Böse auch als menschliches Vermögen. Prinzipiell sind schon in der Antike beide Sichtweisen zu finden. Das Böse wurde sowohl internalisiert als auch externalisiert.
In der alttestamentlichen Forschung ist seit Langem umstritten, ob dort ein Dualismus zwischen Gut und Böse vorliegt. Ein Schlüsseltext in der Debatte ist zweifellos der Prolog des Hiobbuches (1,6–12). Der Text, der bei unvoreingenommener Lektüre einen Dialog zwischen Gott und Satan schildert, wird heute zumeist nichtdualistisch interpretiert. Demnach spiegele dieser Text ein widersprüchliches Gottesbild. Satan repräsentiere nicht eine selbstständige Macht jenseits eines allmächtigen Gottes, sondern vielmehr die dunkle Seite dieses einen Gottes. Dämonen und ihr schädliches Wirken seien in Jahwe integriert worden und folglich habe dieser einen dämonischen Charakterzug bekommen. Der Teufel sei maximal ein Beamter Gottes.
Susanne RudnigZelt hinterfragt genau diese prominente Deutung und zeigt in ihrem Aufsatz „Der Teufel und der alttestamentliche Monotheismus“, dass der Satan im Buch Hiob und anderswo als „weitgehend selbstständige Größe“ erscheint und auch nur so seine theologische Funktion erfüllen könne. „Es scheint, dass die alttestamentliche Forschung zum Satan zu sehr von einer modernen Sicht des Monotheismus bestimmt wurde, nach der Gott nicht nur der einzige Gott, sondern auch die
einzige Macht ist“ (S. 3). „Einen Monotheismus im modernen Sinne, der die Existenz aller Mächte außer Gott ausschließt, wird man im Alten Testament folglich nur schwer finden“ (S. 17). Allerdings ist der alttestamentliche Dualismus nicht mit manichäischen Konstellationen vergleichbar, in denen Gott und dem Satan vergleichbare Machtfülle zukommt. „Vielmehr scheint man von der Herrschaft Jahwes über andere Himmelsmächte auszugehen, seien das Götter oder der Satan. Ähnliche Vorstellungen finden sich in zwischentestamentlichen Texten und im Neuen Testament (vgl. z. B. 1 Kor 8,5f; Phil 2,10; Kol 1,16), so dass hier eine größere Kontinuität zwischen dem Alten Testament und jüngerer Literatur besteht, als die bisherige Forschung gesehen hat“ (S. 17).
Im Sammelband werden viele andere Fragen behandelt, etwa geht Ryan E. Stokes in „What is a Demon, What is an Evil Spirit, and What is a Satan?“ der Frage nach, ob die heute geläufige Gleichsetzung von Dämonen und bösen Geistern durch die frühjüdische Literatur gedeckt ist. Stokes belegt, dass bis ins 1. Jahrhundert n. Chr. zwischen Dämonen und bösen Geistern unterschieden wurde. „In Anknüpfung an das Alte Testament wurden die falschen Götter, die die Heiden verehren, meist als Dämonen bezeichnet. Böse Geister waren dagegen dafür zuständig, die Menschen zu quälen, mit Krankheiten zu schlagen und zu bösen Taten zu verführen“ (S. XI).
Oda Wischmeyer favorisiert in ihrem Beitrag „Zwischen Gut und Böse: Teufel, Dämonen, das Böse und der Kosmos im Jakobusbrief“ eine internalisierte Sichtweise. Zwar lasse der Brief eine Verselbständigung des Bösen erkennen. Diese Tendenz werde freilich zugleich abgebremst (S. 167):
„Das Böse spielt im Jakobusbrief eine entscheidende Rolle, in gewisser Weise kann man das Böse als die Größe beschreiben, die für den Verfasser die eigentliche Realität im Kosmos und auch in den christlichen Gemeinden darstellt. Die Kategorie des Bösen ist für die Anthropologie des Briefes von entscheidender Bedeutung. Der Brief endet mit der Schlussklausel: ‚die Menge der Sünden‘ (5,20). Die Sünden sind die konkrete Erscheinungsform des Bösen, so wie die guten Taten die konkrete Erscheinungsform des Glaubens sind. Demgegenüber sind die Dämonen Staffage des von der Religion des Judentums bestimmten Weltbildes des Verfassers, Teil des als negativ erlebten Kosmos und haben keine eigene positive Bedeutung. Auch der Teufel hat keine eigene Rolle. Ex negativo macht das religiös korrekte Bekenntnis der Dämonen aber deutlich, dass sie zur Welt des Bösen gehören, die destruktiv und zu guten Taten unfähig ist. Das Böse selbst liegt weder im Teufel noch in den Dämonen, sondern im Menschen, und der Mensch muss es bekämpfen, indem er das königliche Gesetz bzw. das Gesetz der Freiheit hält, das Gebot der Nächstenliebe nach Lev 19,18 (2,8.12).“
Eine aus meiner Sicht befangene Deutung, schreibt doch der Autor des Briefes (Jak 4,7): „So seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch.“ Dass der Teufel und die Dämonen bei Jakobus nur als polemische Strategie im Kampf gegen Ängste und Sünde in Anschlag gebracht werden und das Dämonische letztlich zur Sphäre des Psychischen gehört, ist eine Anschauungsweise, die von der Annahme: Satan oder Dämonen kann es aus heutiger Sicht nicht geben, bestimmt ist.
Obwohl so manche präsentierte These kritische Rückfragen oder sogar Einspruch provoziert, ist es erfreulich, dass durch das Buch ein neues Interesse an der theologischen Durchdringung des Bösen erkennbar wird. Es ist tragisch, dass die christliche Theologie angesichts der grauenhaften Präsenz des Bösen bei dieser Frage so zurückhaltend auftritt. Bleibt zu wünschen, dass man sich nicht nur religionswissenschaftlich und religionshistorisch dem Thema nähert, sondern es auch wieder biblischtheologisch aufarbeitet. Die Heilige Schrift hat zu dieser Thematik erstaunlich viel zu sagen.
Sehr erfreulich finde ich, dass trotz divergierender Auffassungen im Resümee zum Ausdruck gebracht wird: a) die jüdischchristliche Literatur kennt sehr wohl den Dualismus und zugleich ist b) das Böse dem souveränen Gott deutlich untergeordnet (vgl. XIII).
(rk)
 In Deutschland wurde Fantômas vor allem durch drei französische 60er-Jahre-Spielfilme bekannt, in denen Louis de Funès als orientierungsloser Kommissar dem souveränen Verbrecher mit der Maske erfolglos hinterher jagte. Ich habe alle Filme mehrmals gesehen und immer wieder von Neuem lachen können.
In Deutschland wurde Fantômas vor allem durch drei französische 60er-Jahre-Spielfilme bekannt, in denen Louis de Funès als orientierungsloser Kommissar dem souveränen Verbrecher mit der Maske erfolglos hinterher jagte. Ich habe alle Filme mehrmals gesehen und immer wieder von Neuem lachen können.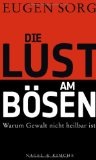 Die Lust an der Grausamkeit ist größer als alle moralischen Hemmungen. Drei neue Studien gehen dem Ursprung des Bösen nach. Über
Die Lust an der Grausamkeit ist größer als alle moralischen Hemmungen. Drei neue Studien gehen dem Ursprung des Bösen nach. Über  Das von Christian Herrmann herausgegebene Themenbuch zur christlichen Ethik:
Das von Christian Herrmann herausgegebene Themenbuch zur christlichen Ethik: Vor 40 Jahren hat die so genannte »Manson Family« in Hollywood mehrere grausame Morde begangen. Susan Atkins, heute 61 Jahre alt, ist verantwortlich für den Mord an der Schauspielerin Sharon Tate, damals die im achten Monat schwangere Ehefrau des Regisseurs Roman Polanski. (Polanski hatte zuvor (1968) den Film »Rosmaries Baby« in dem Haus gedreht, vor dem 1980 John Lennon ermordet wurde).
Vor 40 Jahren hat die so genannte »Manson Family« in Hollywood mehrere grausame Morde begangen. Susan Atkins, heute 61 Jahre alt, ist verantwortlich für den Mord an der Schauspielerin Sharon Tate, damals die im achten Monat schwangere Ehefrau des Regisseurs Roman Polanski. (Polanski hatte zuvor (1968) den Film »Rosmaries Baby« in dem Haus gedreht, vor dem 1980 John Lennon ermordet wurde).