Quotenregelung als Baustein politischer und bürokratischer Zwangsmaßnahmen
Als Telekom-Vorstand führte Thomas Sattelberger die erste Frauenquote in einem DAX-Konzern ein und wurde von Angela Merkel als „Quotenkönig“ gefeiert. Noch einmal würde er die identitätspolitische Politik nicht unterstützten. Heute warnt er vor dem „Unheil einer quotierten Gesellschaft“.
In einem Gastbeitrag schreibt Sattelberger:
Vor dem Hintergrund dogmatischer Quotendebatten und irregeleiteter Diversity-Politik im Deutschland der vergangenen 15 Jahre stelle ich mir die Frage, ob ich heute alles noch einmal so machen würde wie damals, am 15. März 2010, bei der offiziellen Verkündung der Telekom-Frauenquote im Management.
ch gestehe, mein Bauchweh ist so groß geworden, dass ich in der ersten Antwort lautstark „Nein“ rufen würde angesichts der Stupidität, mit der Akteure in Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft dieses Thema getrieben haben. Für mich war Frauenquote für die Spitze sowie Talent- und Kulturarbeit für die Breite immer eine Paketlösung. Und ich habe immer peinlich darauf geachtet, dass Politik für die Gleichberechtigung der Frau nicht Untermenge einer undifferenzierten Diversity-Politik wird. Ich habe immer wieder gesagt: Wir müssen aufpassen, dass wir unter diesem Begriff „Diversity“ die besondere Rolle der Frauen, die ja die Hälfte der Bevölkerung ausmachen und Verfassungsrang haben, nicht mit benachteiligten Minderheiten vermischen. Frauen sind zwar benachteiligt, aber sie sind keine Minderheit! Aber die Personaler dieser Republik – wohlgemerkt: die dummen! – haben das Konzept „Diversity“ tumb aufgegriffen.
Währenddessen hat die Politik die Quote top down und isoliert von Kulturarbeit in immer mehr betroffene Unternehmen reingedrillt – so, wie man es in Bergwerken macht. In vielen mittelständischen Unternehmen hat man dieses Drillen als verletzend und als die unternehmerische Freiheit massiv beeinträchtigend angesehen und Zahlenvorgaben nur unter Zwang erfüllt. Nicht, weil Unternehmer frauenfeindlich sind, sondern weil sie die Quote als weiteren Baustein politischer und bürokratischer Zwangsmaßnahmen ansehen. Deswegen haben dann zu viele Unternehmen unter dem gesetzlichen Zeitdruck nur personelle Rekrutierungs- und Besetzungspolitik im Führungskörper ihrer Unternehmen statt auch Talentpolitik und Personalentwicklung für Vielfalt gemacht. Die Telekom war early innovator mit ihrer freiwilligen Selbstverpflichtung. Doch kaum jemand folgte freiwillig nach. Der allmächtige Staat hat das Thema in seine Hand genommen, technokratisch umgesetzt, sozusagen sein Dogma gesetzt. Und in der Spätphase der Ampel-Koalition hat diese durch das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz den Frauenrechten einen Bärendienst ohnegleichen erwiesen.
Mehr: www.welt.de.
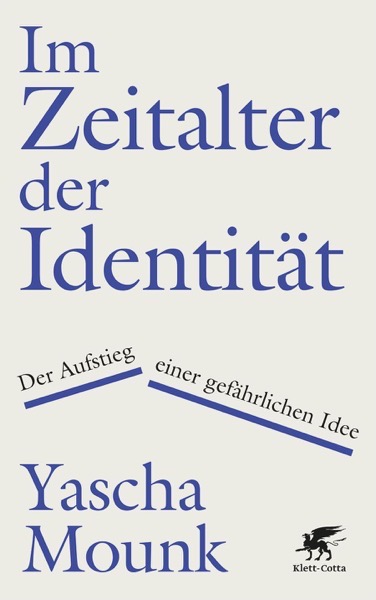 Yascha Mounk (Johns Hopkins Universität, Baltimore, USA) gehört zu den profunden Kritikern der Identitätspolitik. Genau genommen spricht er inzwischen von der „Identitätssynthese“, weil die Bezeichnungen „Identitätspolitik“ oder „Wokeismus“ mit der Zeit immer umstrittener wurden. Wer über Identitätspolitik spricht oder einen Aktivisten als woke bezeichnet, wird schnell als Wutbürger wahrgenommen.
Yascha Mounk (Johns Hopkins Universität, Baltimore, USA) gehört zu den profunden Kritikern der Identitätspolitik. Genau genommen spricht er inzwischen von der „Identitätssynthese“, weil die Bezeichnungen „Identitätspolitik“ oder „Wokeismus“ mit der Zeit immer umstrittener wurden. Wer über Identitätspolitik spricht oder einen Aktivisten als woke bezeichnet, wird schnell als Wutbürger wahrgenommen.