Glaube schrumpft auch in Amerika
Lange waren die Amerikaner deutlich frommer als die Europäer. Inzwischen gibt es auch in den Kirchen Nordamerikas immer mehr leere Plätze. Weniger als die Hälfte der Amerikaner ist noch Mitglied einer Kirche. Die NZZ schreibt:
Die Religiosität der Amerikaner nimmt rasant ab. Die Säkularisierung, die in Europa schon viel früher einsetzte, holt nun auch die USA ein. Nach einer Gallup-Umfrage sind nur noch 47 Prozent der Bürger Mitglied einer Kirche, einer Synagoge oder einer Moschee. Das ist der tiefste Wert, seit das Meinungsforschungsinstitut vor 80 Jahren mit diesen Erhebungen begann. 1999 gehörten noch 70 Prozent einer Kirche oder einem anderen Gotteshaus an.
Der Niedergang beschränkt sich allerdings nicht auf die institutionalisierte Religion, sondern er betrifft auch den Glauben generell. So beten heute nur noch 45 Prozent der erwachsenen Amerikaner täglich. 2007 waren es noch 58 Prozent.
Es ist auch nicht so, dass die Ungläubigkeit lediglich unter der nachwachsenden Generation verbreitet ist. Es gibt rund 40 Millionen erwachsene Amerikaner, die zur Kirche gingen, jedoch damit aufgehört haben. Der Trend geht durch alle Bevölkerungsschichten hindurch: Junge, Alte, Männer, Frauen, Weisse, Schwarze – fast alle Glaubensrichtungen sind von der Schrumpfung betroffen, wenn auch in verschiedenem Masse.
Die üblichen Verdächtigen, die im Artikel „Auch die Amerikaner glauben immer weniger an Gott“ gennannt werden – etwa Missbrauchsfälle und Heuchelei, haben meines Erachtens ursächlich weniger mit der Säkularisierung zu tun als behauptet. Das soziale Vorstellungsschema, um mal den Begriff von Charles Taylor zu verwenden, wird auch von anderen Entwicklungen massiv beeinflusst – denken wir nur an die Musik- und Filmindustrie. Aber das ist ein anderes Thema.
Mehr: www.nzz.ch.
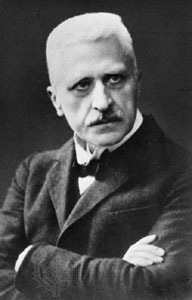 Nur wenige Werke haben das Verständnis von Religion im 20. Jahrhundert so nachhaltig geprägt wie
Nur wenige Werke haben das Verständnis von Religion im 20. Jahrhundert so nachhaltig geprägt wie