Gestern sprach Ulrich Parzany in einem Münchner Studentenwohnheim über die Krise der Kirche. Nicht allen hat das gefallen. Das kirchliche Wohnheim wurde mit Regenbogenfahnen ausgeschmückt. Etliche Zuhörer ergriffen modisch Partei, etwa, indem sie ihre Shirts mit missionarischen Bannern dekorierten. Auf einem Aufkleber war zu lesen: „I can’t even think straigth“ (dt. „Ich kann nicht einmal geradlinig (o. klar/normal) denken“). Der Ausspruch geht zurück auf einen Film, der mehrere Preise auf schwul-lesbischen Filmfestivals abgeräumt hat. Gemeint ist wohl: „Ich kann nicht einmal heterosexuell denken.“
Am Schluss der Veranstaltung wurde es leicht gallig. Aktuelle und ehemalige „Bewohner*innen“ standen auf und brachten in einer Stellungnahme ihre Sorge darüber zum Ausdruck, dass Ulrich Parzany erlaubt wurde, in einem „pluralen und weltoffenen Haus“ zu sprechen. Sie kritisierten „aufs Schärfste, dass Parzanys diskriminierende Thesen hier in unserem Haus eine Bühne geboten wird“. Das war bemerkenswert. Der Text war gedruckt, bevor Parzany überhaupt ein Wort gesagt hatte. Zuhören war nicht die Stärke vieler Aktivist*innen. Die Performance hat fühl- und sichtbar gemacht, was manche als „Intoleranz der Toleranz“ bezeichnen: Im Namen der Toleranz wird Andersdenkenden der offene Diskurs verweigert; mit solidarischem Gruppendruck.
Insgesamt waren die Veranstalter allerdings ernstlich darum bemüht, Ulrich Parzany mit Respekt zu begegnen. Ihnen und dem freundlichen Ton des Referenten ist es zu verdanken, dass das Event nicht durch eine aggressive Atmosphäre vergiftet wurde.
Nun aber zu meinem Anliegen (auf das ich aus Zeitgründen nur skizzenhaft eingehen kann): Nachdem Ulrich Parzany seinen Vortrag beendet hatte, kam der Moment, auf den etliche Gäste gewartet hatten. Es sollte von nun an vor allem um Sexualität und Bibelkritik gehen.
Eine junge Frau ergriff engagiert das Wort und verwies darauf, dass eine behauptete binäre Geschlechterpolarität von Mann und Frau sich gerade nicht auf 1Mose 1,27 berufen könne, wie Parzany behauptet habe. Dort sei nämlich gar nicht davon die Rede, dass Gott den Menschen als Mann und Frau erschaffen habe. Richtig übersetzt müsse es heißen: „Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie männlich und weiblich.“
Tatsächlich steht im hebräischen Text „Adam“ im Singular. Auch „Männlein“ und „Fräulein“, wie Luther übersetzte, findet sich dort nicht, sondern adjektivisch „männlich“ und „weiblich“. Wird damit die Schaffung eines androgynen Menschen behauptet, eines Wesens also, das männlich und weiblich zugleich ist? Die Zuhörerin war davon fest überzeugt.
Es gibt entsprechende Auslegungsspuren. Schon Rabbi Samuel ben Nahman schrieb im 3. oder 4. Jahrhundert, dass Gott den Menschen als „Androgynos“ erschaffen habe. Rabbi Simeon ben Lakisch sagte runde einhundert Jahre früher, Gott haben den Menschen mit zwei Gesichtern, einem weiblichen und einem männlichen, geschaffen. Im pseudepigraphischen Buch „Apokalypse des Adam“, das wahrscheinlich aus dem 1. Jahrhundert stammt, beschreibt Adam seine Schöpfung wie folgt:
Als Gott mich aus der Erde erschaffen hatte, zusammen mit Eva, deiner Mutter, ging ich mit ihr in einer Herrlichkeit um, die sie in dem Alter gesehen hatte, aus dem wir hervorgegangen waren. Sie lehrte mich ein Wort der Erkenntnis über den ewigen Gott. Und wir glichen den großen ewigen Engeln, denn wir waren höher als der Gott, der uns erschaffen hatte, und die Kräfte mit ihm, die wir nicht kannten. Dann zerteilte Gott, der Herrscher über die Äonen und die Mächte, uns im Zorn. Dann wurden wir zwei Äonen. Und die Herrlichkeit in unserem Herzen verließ uns, mich und deine Mutter Eva, zusammen mit dem ersten Wissen, das in uns atmete.
Spätestens hier sollte erkennbar werden, woher der Wind weht. Zurecht wurden von jüdischen Schriftgelehrten diese Auslegungen entschieden zurückgewiesen. Die These vom „Mannweib“ zeigt nämlich offenkundig Parallelen zur Gnosis. Insbesondere das Werk Symposium (o. Gastmahl) des Platon lieferte eine Vorlage. Aristophanes ergreift darin das Wort und sagt (ich zitiere die Übersetzung von Schleiermacher, Sämtliche Werke in drei Bänden, Bd. 1, WBG, 2004, S. 681–682):
Unsere ehemalige Naturbeschaffenheit nämlich war nicht dieselbe wie jetzt, sondern von ganz anderer Art. Denn zunächst gab es damals drei Geschlechter unter den Menschen, während jetzt nur zwei, das männliche und das weibliche; damals kam nämlich als ein drittes noch ein aus diesen beiden zusammengesetztes hinzu, von welchem jetzt nur noch der Name übrig ist, während es selber verschwunden ist. Denn Mannweib war damals nicht bloß ein Name, aus beidem, Mann und Weib, zusammengesetzt, sondern auch ein wirkliches ebenso gestaltetes Geschlecht; jetzt aber ist es nur noch ein Schimpfname geblieben. Ferner war damals die ganze Gestalt jedes Menschen rund, indem Rücken und Seiten im Kreise herumliefen, und ein jeder hatte vier Hände und ebenso viele Füße und zwei einander durchaus ähnliche Gesichter auf einem rings herumgehenden Nacken, zu den beiden nach der entgegengesetzten Seite von einander stehenden Gesichtern aber einen gemeinschaftlichen Kopf, ferner vier Ohren und zwei Schamteile, und so alles übrige, wie man es sich hiernach wohl vorstellen kann … Es waren aber deshalb der Geschlechter drei und von solcher Beschaffenheit, weil das männliche ursprünglich von der Sonne stammte, das weibliche von der Erde, das aus beiden gemischte vom Monde, da ja auch der Mond an der Beschaffenheit der beiden anderen Weltkörper teilhat; eben deshalb waren sie selber und ihr Gang kreisförmig, um so ihren Erzeugern zu gleichen … Zeus nun und die übrigen Götter hielten Rat, was sie mit Ihnen anfangen sollten, und sie wußten sich nicht zu helfen; denn sie wünschten nicht, sie zu töten und ihre ganze Gattung zugrunde zu richten, … Endlich nach langer Überlegung sprach Zeus: „Ich glaube ein Mittel gefunden zu haben, wie die Menschen erhalten bleiben können und doch ihrem Übermut Einhalt geschieht, indem sie schwächer geworden. Ich will nämlich jetzt jeden von ihnen in zwei Hälften zerschneiden, und so werden sie zugleich schwächer und uns nützlicher werden, weil dadurch ihre Zahl vergrößert wird, und sie sollen nunmehr aufrecht auf zwei Beinen gehen …”
Schon vor 1800 Jahren gab es für Schriftausleger die Versuchung, sich bei der Exegese von extrabiblischen Narrativen oder prominenten weltanschaulichen Leitmotiven lenken zu lassen. So ist es kaum verwunderlich, dass am Rande des Juden- oder Christentums alle möglichen Deutungen zu finden sind. Vielfalt eben!
Die These von der Schöpfung eines „Mannweibes“ hat sich jedoch nie etablieren können. Zu eindeutig ist der ausführliche Schöpfungsbericht im 2. Kapitel der Genesis (vgl. bes. 1Mose 2,24 und Jesu Bezugnahme in Mt 19,3–6). So bestätigt das Argument der Zuhörerin streng genommen die These Parzanys: Schon damals unterschieden die Schriftgelehrten zwischen der Offenbarung, die Gott ihnen anvertraut hatte, und umliegenden Erzählungen. Bindend war das göttliche Wort. Deshalb konnten sich im Raum der Kirche prämoderne „Freuds“ oder „Kinseys“ nicht durchsetzen. Anders gesagt: Die Väter der Kirche konnten zwischen einem Lukasevangelium und Thomasevangelium unterscheiden.
Malka Simkovich, die sich gründlich mit der Auslegung von 1Mose 1,27 im rabbinischen Judentum beschäftigt hat, schreibt treffend:
Die Lektüre des Midraschs im Lichte der platonischen und pseudepigraphischen Literatur hilft uns zu verstehen, wie sie gemeinsame Traditionen, die in der Antike wohlbekannt waren, übernahmen, um ihre eigene einzigartige Theologie kreativ zu fördern. Wie heute, wo intellektuelle Theologen oft versuchen, die moderne Wissenschaft mit dem Schöpfungsbericht in der Genesis zu harmonisieren, waren sich die Rabbiner der Antike der populärwissenschaftlichen Philosophie ihrer Zeit bewusst und integrierten sie …
Tja, das ist in unseren Tagen leider nicht anders als damals. Anstatt die Schrift im Lichte der Schrift auszulegen, überfrachten viele ihre Exegese mit Kulturbezügen. Die gehorchende Gemeinde widersteht dieser Versuchung. Denn wenn die Theologie der Gegenwart den Mahnruf Parzanys, nämlich wieder auf Gottes Offenbarung in der Schrift zu hören, nicht erst nimmt, wird sie wohl bald keiner mehr vermissen.
– – –
Hier ein hilfreicher Artikel von Malka Z. Simkovich mit Quellenangaben (auf die ich verzichtet habe):

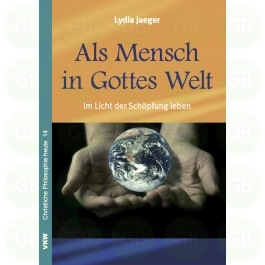 Die deutsche Ausgabe des Buches Vivre dans un Monde créé ist endlich erschienen. Ich danke allen, die zum Gelingen von Als Mensch in Gottes Welt beitragen haben: der Übersetzerin Silke Denker, Johannes, Beate, Bettina und natürlich der Autorin Lydia Jaeger.
Die deutsche Ausgabe des Buches Vivre dans un Monde créé ist endlich erschienen. Ich danke allen, die zum Gelingen von Als Mensch in Gottes Welt beitragen haben: der Übersetzerin Silke Denker, Johannes, Beate, Bettina und natürlich der Autorin Lydia Jaeger. Die Ausgabe 1/2012 der Zeitschrift Glauben und Denken heute ist soeben (zusammen mit dem Release der neuen Website
Die Ausgabe 1/2012 der Zeitschrift Glauben und Denken heute ist soeben (zusammen mit dem Release der neuen Website  Am 14. November habe ich hier das Buch Wissenschaft ohne Gott? von Lydia Jaeger kurz
Am 14. November habe ich hier das Buch Wissenschaft ohne Gott? von Lydia Jaeger kurz