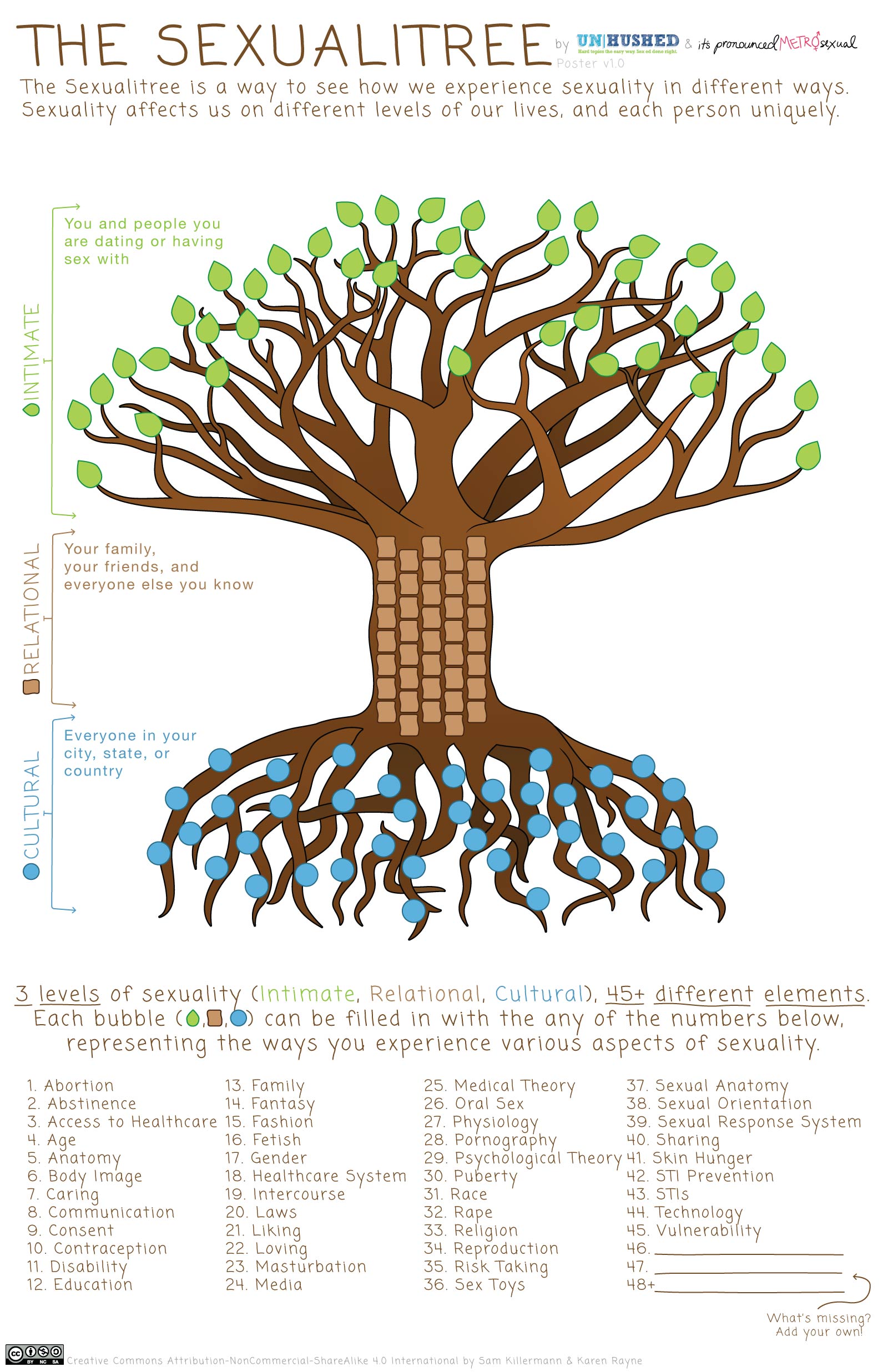Ein junges, verlobtes Pärchen kämpft mit der Frage, ob Sex vor der Ehe in Ordnung ist und wendet sich deshalb an einen evangelischen Pfarrer, der auf evangelisch.de seine Antwort öffentlich macht. Der Geistliche schreibt dort unter anderem:
Wenn jemandem wichtig ist, dass die Ehe allein der Ort für Sex ist, wird dieser jemand immer Argumente dafür finden. Das gilt insbesondere, wenn dieser jemand ein frommer Mensch ist und die Bibel als Argumentationshilfe nutzt. Das Problem dabei ist, dass dabei eigene Moralvorstellungen unhinterfragt auf antike Texte übertragen werden. Redlicher ist es, die Texte genau anzuschauen und zu erkennen, was sie aus sich selbst heraus sind.
Und weiter schreibt er:
Die Bibel dafür heranzuziehen, Paaren zu verbieten, vor der Ehe Sex zu haben, empfinde ich als unredlich gegenüber der Bibel selbst. Besonders ärgerlich werde ich, wenn diese Menschen sagen, sie würden die Bibel ernst nehmen, weil sie ja eindeutig sei. Wer das behauptet, meint in der Regel die eigene Auslegung und nicht die Bibel. Wie ich bereits schrieb: Die Moral steckt nicht im Hohenlied, sondern in den Köpfen der Interpretierenden.
Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man diese seelsorgerische Antwort mit Humor nehmen. Zu offensichtlich macht der Pfarrer genau das, was er den (aus seiner Sicht) unaufrichtigen Bibellesern unterstellt: „Das Problem dabei ist, dass dabei eigene Moralvorstellungen unhinterfragt auf antike Texte übertragen werden.“ Mit einer Geste der Überlegenheit und Reife projiziert er seine Vorstellungen zur Sexualität (die – so dürfen wir vermuten – von der Sexuellen Revolution imprägniert sind) auf die biblischen Texte zurück; gegen ihren Sinngehalt und gegen ihre lange Auslegungsgeschichte.
Dass für das Judentum der Sex in die Ehe gehört, kann man in so gut wie jedem Standardwerk nachlesen. „Das erste biblische Gebot über die Fortpflanzung des Menschengeschlechts soll nur in der Ehe erfüllt werden (TRE, Bd. 9, 1982, S. 314). Das Judentum kennt ein klares Ideal, nämlich den ehelichen Sex. Dennis Prager schreibt in „Das Geschenk des Judentums an unsere Kultur“:
Alle anderen Formen sexuellen Verhaltens, obwohl sie nicht alle gleich verwerflich sind, weichen von diesem Ideal ab. Je mehr sie abweichen, desto ausgeprägter ist die Abneigung des Judentums gegen dieses Verhalten.
Das Alte Testament selbst verortet die Sexualität eindeutig in der Ehe. Zum Erweis vorehelicher Keuschheit bewahrten die jüdischen Familien etwa das Hochzeitsgewand als „Beweisstück“ auf (vgl. 5Mose 22,13ff). Oder: „Wenn jemand eine Jungfrau beredet, die noch nicht verlobt ist, und schläft bei ihr, so soll er den Brautpreis für sie geben und sie zur Frau nehmen“ (2Mose 22,15).
Und das Neue Testament? Jesus hat die alttestamentliche Eheordnung bestätigt und in gewisser Hinsicht sogar strenger ausgelegt als das Judentum (vgl. Mt 5,27ff). Und Paulus können wir nicht gegen Jesus ausspielen. Für den Apostel gehörte Sex in den Ehebund. So schreibt er etwa in 1Thess 4,3–8 (ELB):
Denn dies ist Gottes Wille: eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet, dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen weiß, nicht in Leidenschaft der Begierde wie die Nationen, die Gott nicht kennen; dass er sich keine Übergriffe erlaubt noch seinen Bruder in der Sache übervorteilt, weil der Herr Rächer ist über dies alles, wie wir euch auch vorher schon gesagt und eindringlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Deshalb nun, wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in euch gibt.
Ich zitiere mal Douglas Moo dazu (A Theology of Paul and His Letters, Zondervan, 2021, S. 631–632):
Wenn wir über die Ehe diskutieren, müssen natürlich auch ein paar Worte zum Thema Sex gesagt werden. Zur Zeit des Paulus, so wie auch zu unserer Zeit, war Sex ein Lebensbereich, in dem die biblischen Maßstäbe besonders hart mit den zeitgenössischen Sitten kollidierten. Es überrascht uns daher nicht, dass er seinen nichtjüdischen Bekehrten einige Warnungen mit auf den Weg gibt. Wie ich bereits erwähnt habe, ist Sexualität der Bereich der Sündhaftigkeit, den Paulus am häufigsten in seinen Lasterkatalogen erwähnt. 1Thess 4 ist besonders pointiert. Paulus wiederholt hier, was er jenen hauptsächlich nichtjüdischen Bekehrten in der kurzen Zeit, die er mit ihnen verbracht hat, darüber gelehrt hat – wie sie leben sollen, „um Gott zu gefallen“ (V. 1). Das erste, was er erwähnt und mit ihrer Heiligung in Verbindung bringt (V. 3), ist die Notwendigkeit, „sexuelle Unmoral zu meiden“ (porneia, das griechische Wort für unangemessenes sexuelles Verhalten). Wie ich oben dargelegt habe, konkretisiert Paulus dies, indem er die Gläubigen auffordert, ihre Geschlechtsorgane „in heiliger und ehrbarer Weise“ zu gebrauchen (V. 4). Paulus folgt dem jüdischen Präzedenzfall, indem er unangemessenes sexuelles Verhalten als ein besonders deutliches Anzeichen dafür sieht, wie sich die Menschen von der Anbetung Gottes abgewandt haben (vgl. Röm 1,24–27).
Obwohl dieser Abschnitt an Nichtjuden geschrieben wurde, zeigt er auch, dass sich Paulus in seiner ethischen Lehre dem Alten Testament verpflichtet fühlt. Der Abschnitt ist durchdrungen von Aufrufen zur Heiligkeit (1Thess 4,3.4.7), die an den bekannten alttestamentlichen Aufruf zur Heiligkeit anknüpfen (z.B. Lev 11,44; siehe oben). Paulus’ Verweis auf die Gabe des Heiligen Geistes in V. 8 erinnert an die Verheißung in Hesekiel 36,25–27, dass Gott sein Volk durch eine neue Ausgießung seines Geistes von „Unreinheit“ und Götzendienst „reinigen“ würde (vgl. 1Thess 1,9). Die vielleicht klarste theologische Grundlage für Paulus’ Aufruf zur sexuellen Reinheit findet sich in 1Korinther 6,12–20. Als Antwort auf eine korinthische Ansicht, die den Körper offenbar als unwichtig für das geistliche Leben ansah, bekräftigt Paulus hier die Bedeutung des Körpers und unterstreicht daher die Notwendigkeit, den Körper im sexuellen Bereich angemessen zu gebrauchen. Man darf sich nicht mit Prostituierten zusammentun, denn das würde die intime und exklusive Verbindung der Gläubigen mit Christus verletzen (V. 15–17). Unsere Leiber sind in der Tat „Tempel des Heiligen Geistes“ (V. 19). Gläubige müssen, so schließt Paulus, „Gott mit [ihren] Leibern ehren“ (V. 20) – und das bedeutet natürlich, sie im sexuellen Bereich so zu gebrauchen, dass sie Gott wohlgefällig sind.
Auch Christen sündigen. Was haben die antiken Gläubigen in den Gemeinden getan, wenn ein unverheiratetes Paar doch Sex vor der Ehe hatte? Armin Baum wird mit seiner Vermutung richtig liegen:
Wie Paulus oder die paulinischen Gemeinden mit festen Paaren verfahren
sind, die unverheiratet Geschlechtsverkehr hatten, wird im Neuen Testament
nirgends ausdrücklich gesagt. Am wahrscheinlichsten ist, dass man
eine ähnliche Differenzierung vornahm wie im 5. Mosebuch (Dtn 22,13–29). Man kann daher vermuten, „dass eine christliche Gemeinde, wenn ein
solches Verhalten bekannt geworden wäre, es missbilligt und … auf die
Legalisierung des Verhältnisses gedrungen hätte“.
VD: WH