Kierkegaards Sprung (Teil 1)
Das kurze Leben eines Genies
 Sören Kierkegaard wird am 5. Mai 1813 als jüngstes von sieben Kindern geboren. Sein Vater, ein wohlhabender Wollwarenhändler, ist bereits 57 Jahre alt. Seine Mutter und fünf seiner Geschwister sterben innerhalb weniger Jahre.
Sören Kierkegaard wird am 5. Mai 1813 als jüngstes von sieben Kindern geboren. Sein Vater, ein wohlhabender Wollwarenhändler, ist bereits 57 Jahre alt. Seine Mutter und fünf seiner Geschwister sterben innerhalb weniger Jahre.
Von 1830 bis 1840 studiert Kierkegaard an der Universität Kopenhagen Philosophie und protestantische Theologie. 1841 hört er auch Vorlesungen bei Friedrich Schelling (1775–1854) in Berlin, wendet sich nach anfänglicher Begeisterung jedoch schnell wieder von ihm ab. Kierkegaard lernt gemächlich (über zwanzig Semester bis zu seinem Examen) und genießt das Kulturleben in vollen Zügen. Bei seinen Kommilitonen ist er für seine Schlagfertigkeit und den »bissigen Witz« bekannt. Gern besucht er die Theater und Salons Kopenhagens. Am 8. Dezember 1937 schreibt er in sein Tagebuch: »Ich denke, wenn ich einmal ein ernster Christ werde, dann werde ich mich am meisten darüber schämen, dass ich dies nicht früher geworden bin, sondern alles andere versuchen wollte.«
1837 verliebt sich Sören in die fünfzehnjährige Regine Olsen (1823–1904). Eine 1840 eingegangene Verlobung wird von Sören 1841 überraschend aufgelöst. Der genaue Grund liegt bis heute im Dunkeln. Die gescheiterte Liebesbeziehung wirkt katalysierend auf Kierkegaard’s einsamen Kampf gegen das etablierte Christentum.
Während dieser Zeit beschäftigt sich Kierkegaard intensiv mit den Werken von Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) und promoviert über das Thema »Über den Begriff der Ironie mit mit steter Bezugnahme auf Sokrates«.
Als sein Vater 1838 starb, hinterließ er seinem Sohn ein beträchtliches Erbe. Bis Ende der 40er Jahre kann Kierkegaard so ein gut situiertes Leben als freier Schriftsteller führen. 1843 veröffentlicht er unter dem Pseudonym Victor Eremita sein Hauptwerk Entweder – Oder. Das Buch, das ihn über Nacht (in Kopenhagen) berühmt macht, enthält das berüchtigte »Tagebuch eines Verführers«, in dem er mittelbar seine unglückliche Liebe zu Regine aufarbeitet. Im Verlauf der nächsten zwölf Jahre publiziert er pseudonym oder unter eigenem Namen zahlreiche Bücher, Streitschriften, erbauliche Predigten und Flugblätter. Kierkegaard verwickelt sich dabei in erbitterte Auseinandersetzungen mit der lutherischen Kirche Dänemarks, die für ihn augenfällig durch den Bischof Jakob Peter Mynster (1775–1854) verkörpert wird.
Am 2. Oktober erleidet Kierkegaard einen Schlaganfall und bricht in Kopenhagen auf der Straße zusammen. Da sich sein Zustand nicht bessert, wird er in das Frederiks Hospital überführt. Die Ärzte ahnen, dass das Ende gekommen ist. Der letzte verbliebene Freund, Emil Boesen, darf ins Sterbezimmer und fragt Kierkegaard, ob er im Frieden zu Gott beten könne. Kierkegaard bejaht: »Ja, das kann ich; ich bitte denn zuerst um die Vergebung der Sünden, daß alles vergeben sein möge.« Er gibt Boesen noch eine Bitte mit auf den Weg: »… grüß alle Menschen, ich bin ihnen allen insgesamt sehr zugetan gewesen …«.
Als einen Tag später sein Bruder Peter Christian eintrifft, verweigert Sören ihm das Gespräch. Auch das Abendmahl will er im Sterbebett nicht aus der Hand eines Geistlichen empfangen. Am 11. November 1855 stirbt er, bereits im Koma liegend, im Alter von nur 42 Jahren.
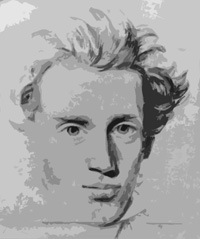 Über den dänischen Philosophen Sören Kierkegaard (1813-1855) gibt es sehr viel zu sagen. Er hielt sich für ein Ausnahmetalent (und war es auch). Er führte ein furchtbar verwirrtes Leben. Er misstraute allem, was vor ihm in der Philosophie behauptet worden war. Er verlagerte das Denken vom Allgemeinen und Objektiven weg in das wirkliche Leben des Einzelnen. Und er erklärte den Menschen in den protestantischen Kirchen, was es bedeutet, an Jesus Christus ›entschieden‹ zu glauben.
Über den dänischen Philosophen Sören Kierkegaard (1813-1855) gibt es sehr viel zu sagen. Er hielt sich für ein Ausnahmetalent (und war es auch). Er führte ein furchtbar verwirrtes Leben. Er misstraute allem, was vor ihm in der Philosophie behauptet worden war. Er verlagerte das Denken vom Allgemeinen und Objektiven weg in das wirkliche Leben des Einzelnen. Und er erklärte den Menschen in den protestantischen Kirchen, was es bedeutet, an Jesus Christus ›entschieden‹ zu glauben.