Ulrich Wilckens (1928–2021)
Der Bischof em. Prof. Dr. Ulrich Wilckens ist am 25. Oktober 2021 heimgegangen. Wilckens bekehrte sich zu Jesus Christus, nachdem er im Schützengraben von einem Panzer überrollt wurde und überlebt hat. Er studierte Theologie und lehrte später in Marburg, Berlin und Hamburg. Von 1981 bis 1991 war er Bischof der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche, die 2012 der Nordkirche zugeschlagen wurde.
Gegen Ende seiner Amtszeit erkrankte Wilckens schwer an Krebs. Dass er überraschend geheilt wurde, schrieb er Gottes Eingreifen zu und nutzte die verbleibenden Jahre für tief schürfende theologische Untersuchungen, die nicht dem Mainstream entsprachen. Er kritisierte die historisch-kritische Methode und verfasste eine sechsbändigen Theologie des Neuen Testaments (siehe meinen Buchhinweis hier: Wilckens.pdf).
Wilckens änderte auch seine Sichtweise auf die Sexualethik. Er überarbeitete seine Kommentar zum Römerbrief und schrieb auf evangelisch.de: Ein Christ müsse „sein sexuelles Verhalten ganz nach dem Willen Gottes ausrichten und daher wissen, dass gleichgeschlechtliches Zusammenleben – wie alle außereheliche Sexualität – dem Gotteswillen widerspricht“.
Im Gedenken an seinen kirchlichen Dienst hier ein längeres Zitat aus seinem Buch Kritik der Bibelkritik:
Es ist zu entscheiden, ob die historisch-kritische Auslegung der Bibel dem Anspruch gerecht wird, den ursprünglichen Sinn der biblischen Schriften zu erfassen, und zu prüfen, ob ihre Zeugnisse von der Wirklichkeit Gottes als wahr anzuerkennen sind – nämlich der Wirklichkeit seines Handelns in der Geschichte Israels und im Wirken und Geschick Jesu als Heilgeschehens für alle Menschen aller Zeiten. Eine solche Prüfung erfordert, beides ernst zu nehmen: die Aussagen der Zeugen in den biblischen Texten und die kritische Absicht der Ausleger.
Was die Prüfung der Letzteren betrifft, so gilt es nicht nur, die behaupteten »Ergebnisse« der modernen Bibelwissenschaft nachzuprüfen, sondern vor allem auch die darin angewandten Methoden auf ihre Voraussetzungen hin zu hinterfragen. Ihrem historisch-kritischen Anspruch entspricht es, dass auch ihre Überprüfung historisch-kritisch verfährt. Und das heißt: Die Geschichte der modernen Bibelforschung ist selbst historisch-kritisch zu verfolgen.
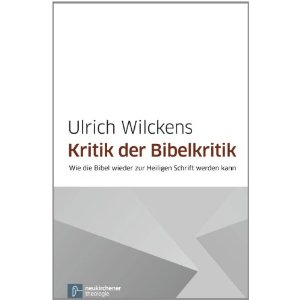 Der emeritierte Neutestamentler Ulrich Wilckens hat Ende 2012 einen Zwischenbilanz seiner Kritik der Bibelkritik vorgelegt.
Der emeritierte Neutestamentler Ulrich Wilckens hat Ende 2012 einen Zwischenbilanz seiner Kritik der Bibelkritik vorgelegt.