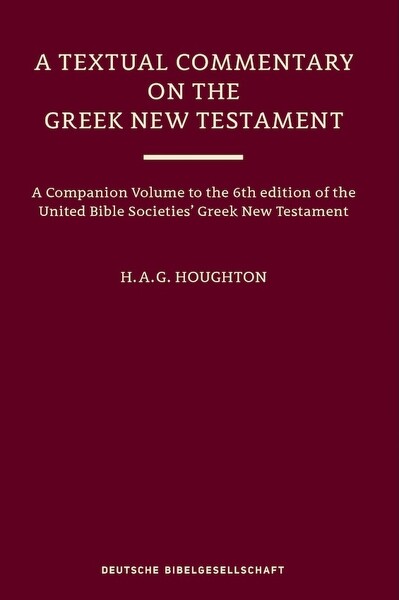
Ein neuer Textual Commentary on the Greek New Testament ist bei der Deutschen Bibelgesellschaft erschienen. Das gleichnamige Werk von Bruce M. Metzger, das sich in seiner letzten Auflage auf das GNT4 aus dem Jahr 1993 bezog, ist damit abgelöst (er ist aber immer noch sehr wertvoll und kann derzeit für nur 9,95 Euro bei der Bibelgesellschaft bezogen werden).
Der neue Textual Commentary präsentiert nicht mehr das Ergebnis einer Arbeitskommision, sondern wird von H.A.G. Houghton verantwortet. Houghton ist Mitglied des Herausgebergremiums für NA29 und GNT6.
Aber was ist das Anliegen des Buches? Der Textual Commentary on the Greek New Testament ist kein Bibelkommentar. Er kommentiert Entscheidungen zur sogenannten Textkritik des Neuen Testaments. Neutestamentliche Textkritik ist ein Teilgebiet der Bibelwissenschaft, das sich mit der Rekonstruktion des ursprünglichen Wortlauts des griechischen Neuen Testaments befasst. Da die die Originalhandschriften (auch Autographen genannt) nicht mehr existieren, stützt sich die Textkritik auf die Auswertung und den Vergleich von Handschriften und anderen Textzeugen, um die wahrscheinlich ursprüngliche Lesart zu ermitteln.
Tanja Bittner hat die Neuausgabe rezensiert und schreibt u.a.:
Um fundiert Textkritik zu betreiben, ist ein beträchtliches Maß an Fachwissen nötig, zum Beispiel in Bezug auf die Charakteristika einzelner Handschriften. Vom durchschnittlichen Theologiestudenten, Pastor oder Bibelübersetzer ist das kaum zu leisten, obwohl textkritische Fragen durchaus für ihn relevant sein können.
Auf eben diese „non-specialists“ (S. VII) ist der Textual Commentary ausgerichtet. Er soll dem Leser helfen, die Arbeit der Textkritiker nachzuvollziehen und sich ein Stück weit eine eigene Meinung zu bilden.
In einer ausführlichen Einleitung (36 Seiten) wird zunächst das nötige Grundwissen vermittelt. Der Leser erhält einen Überblick über die verschiedenen Arten von Zeugen (Papyri, Majuskeln, Minuskeln usw.) und die Prinzipien der Textkritik (äußere und innere Kriterien, die neuen Möglichkeiten der CBGM). Im Abschnitt „Who Changed the Text and How?“ (dt. „Wer veränderte den Text und auf welche Weise?“ Vgl. S. 23–27) geht es um die immer wieder geäußerte Vermutung, die antiken Schreiber hätten sich gewisse Freiheiten beim Abschreiben der Texte genommen und zum Beispiel theologisch nicht genehme Stellen verändert. Damit verkennt man aber die Situation in antiken Schreibstuben und die üblichen Abläufe der damaligen Buchproduktion. Man sollte bei der überwiegenden Zahl der Varianten davon ausgehen, dass es sich um Versehen oder unbewusste Änderungen handelt.
Houghton geht in der Einleitung außerdem kurz auf das Konzept der Texttypen anhand der vermeintlichen geographischen Verortung ein (alexandrinischer, westlicher, Caesarea-Text): Der Textbefund erlaubt es heute nicht mehr, diese Kategorien aufrechtzuerhalten, man sollte sie deshalb nicht mehr als Kriterium verwenden. Einzige Ausnahme ist die Kategorie des Byzantinischen Texts, dessen Vertreter tatsächlich ein hohes Maß an Übereinstimmung aufweisen.
Mehr: www.evangelium21.net.