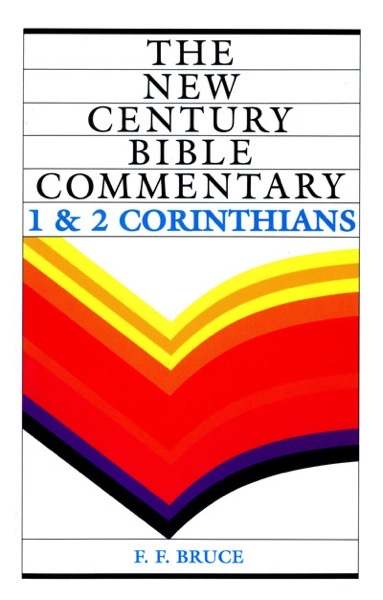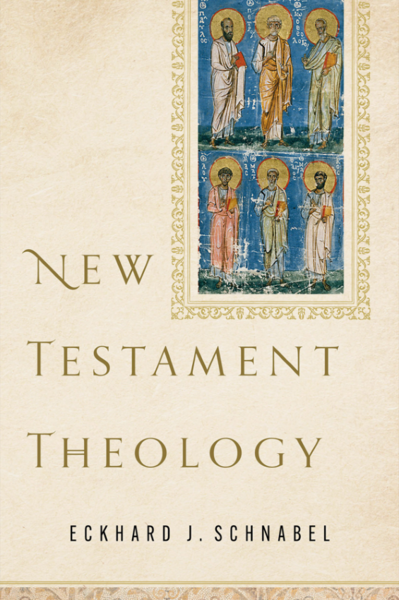The Gospel of Jesus’ Wife
War Jesus verheiratet? Diese Frage bekam im Jahr 2012 Auftrieb, als die Harvard-Professorin Karen L. King einen Papyrus vorgestellt hatte, in dem signalisiert wird, dass Jesus zusammen mit einer Frau lebte. Das Thema wurde von der Presse dankbar aufgenommen. Es gab zum Beispiel Beiträge im DLF, im SONNTAGSBLATT und natürlich bei EVANGELISCH.DE.
Ein paar Jahre später ist Ernüchterung eingetreten. Seit 2020 wissen wir, dass der deutschstämmige Erotikproduzent Walter Fritz für das Papyrus verantwortlich war. Ich zitiere nochmals Anselm Schubert (Christus (m/w/d), München: C.H. Beck, 2024, S. 231–232):
Wie der schwule sollte auch der verheiratete Jesus sein eigenes Evangelium bekommen. 1945 waren im ägyptischen Nag Hammadi umfangreiche Reste frühchristlich-gnostischer Texte gefunden worden. Wir hatten bereits gesehen, dass darin immer wieder ein besonderes Verhältnis zwischen Christus und Maria Magdalena angedeutet wird, Maria Magdalena als Lieblingsjüngerin, als Lehrerin der Jünger oder sogar als «seine Gefährtin» beschrieben wird und Jesus sie küsst, da er sie «mehr liebte als alle Jünger», 133 Das Philippusevangelium deutet an einer Stelle überdies an, es gebe «den Menschensohn, und es gibt den Sohn des Menschensohnes».
Während die wissenschaftliche Forschung darauf hinwies, dass die frühchristliche Gnosis kaum etwas so negativ bewertete wie Körperlichkeit, Geschöpflichkeit und Sexualität und deshalb von Anfang an annahm, dass die Verse eine metaphorische und mystische Bedeutung hatten, mehrten sich seit Bekanntwerden der ersten Übersetzungen um 1970 populär- und pseudowissenschaftliche Darstellungen, die nun reißerisch behaupteten, Jesus habe mit Maria Magdalena ein Kind gezeugt. Diese Debatte berief sich einerseits auf die pseudepigraphischen Evangelien des 19. Jahrhunderts, andererseits auf die neuen Funde und stand eng in Verbindung mit der feministischen «Entdeckung» Maria Magdalenas (…).
2012 verkündete die amerikanische Koptologin Karen L. King die Entdeckung und Entzifferung eines Papyrusfragments, das ein unbekannter Sammler ihr vorgelegt hatte. Das kaum visitenkartengroße Fragment umfasste nur wenige, bruchstückhaft erhaltene Zeilen; aber es war deutlich zu erkennen, dass Jesus an einer Stelle «meine Frau» erwähnt und es wenig später hieß: «sie kann mein Jünger sein». Nach dieser Aussage hatte King das Fragment «Gospel of Jesus‘ Wife» genannt, und unter diesem Namen erfreute sich der Fund für kurze Zeit globaler Aufmerksamkeit. King ließ das Fragment im folgenden Jahr physikalisch und chemisch untersuchen: Sowohl Papyrus als auch Tinte schienen echt. Dennoch meldeten sich Zweifel an der Echtheit des Fragments, denn ein solcher Beweis, dass Jesus eine Frau gehabt hatte, schien einfach allzu sehr dem Zeitgeist zu entsprechen. Hinzu kam, dass nicht nur die Schrift unbeholfen wirkte, der gesamte Bestand des kurzen Textes schien aus Formulierungen des koptischen Thomasevangeliums zu bestehen. Wenig später stellt man fest, dass eine grammatikalische Besonderheit offensichtlich auf einer fehlerhaften Onlineausgabe des Thomasevangeliums aus dem Jahr 2002 beruhte. 2020 identifizierte der Journalist Ariel Sabar den unbekannten Sammler schließlich als den Deutschen Walter Fritz – einen in Florida lebenden Erotikaproduzenten und ehemaligen Koptologiestudenten aus Berlin.