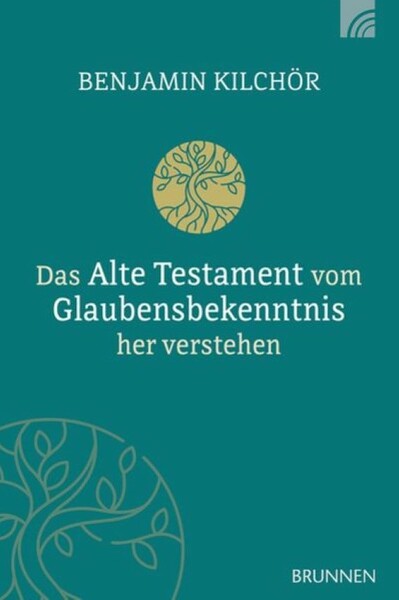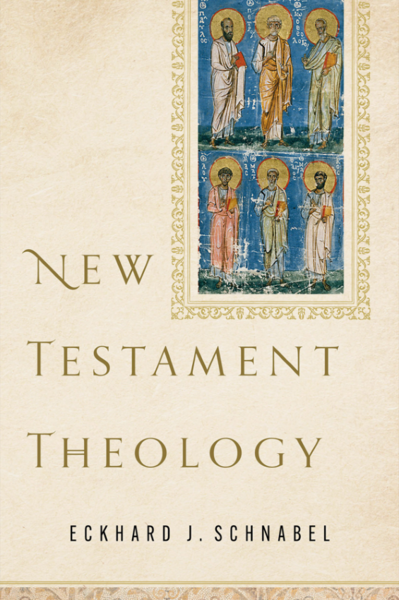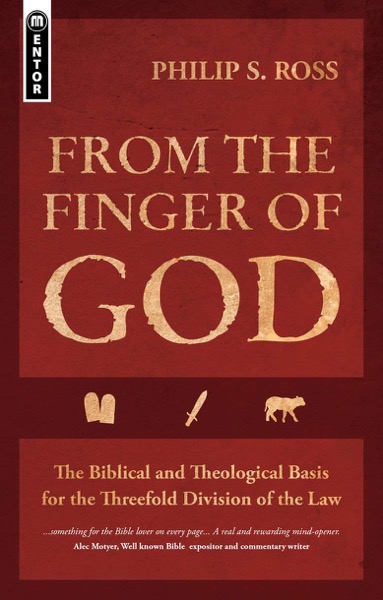Nele Pollatschek sucht in der SZ nach neuen Arguementen in der Abtreibungsdebatte und versteigt sich zu der Behauptung, dass sich die Bibel nur an einer Stelle für den Schutz ungeborenen Lebens ausspricht, nämlich in 1Mose 38:
Wann also beginnt potenzielles Leben? Auf der Suche nach Antworten hilft die Bibel. Ein Buch, das sich in der “ Pro Life“-Bewegung großer Beliebtheit erfreut, obwohl es sich insgesamt eher pro-Schwangerschaftsabbruch geriert – ständig werden Feten in Gottesnamen aus ungläubigen Bäuchen gerissen. Die einzige Passage, die sich explizit für den Schutz potenziellen Lebens starkmacht, findet sich in Genesis 38. Nach dem Tod seines Bruders soll Onan mit dessen Witwe einen Nachkommen zeugen. Allerdings lässt Onan seinen Samen lieber zur Erde fallen, wofür Gott ihn mit dem Tod bestraft.
Wenn die Bibel männlichen Samen als potenzielles Leben ansieht, erkennt sie etwas biologisch Korrektes, denn tatsächlich strebt schon ein Spermium danach, menschliches Leben zu werden, indem es sich auf eine Eizelle zubewegt. Ein Spermium kann vom Bestreben, Leben zu werden, nur abgehalten werden, indem man es statt mit einer Eizelle mit unbelebbarem Milieu konfrontiert. Erde, Taschentuch, Socke, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt.
Da hat sich Frau Pollatscheck freilich verrannt. In 1Mose 38,8–9 weist Juda seinen zweiten Sohn Onan an, den Brauch der „Leviratsehe“ zu erfüllen, wonach ein Bruder die kinderlose Witwe seines Bruders heiraten und ihr Kinder schenken musste (vgl. 5Mose 25,5–10; Rut 1,11–13; 4,1–12; siehe a. Mt 22,24–25; Lukas 20,28). Der Text möchte gar nicht sagen, dass im männlichen Samen ein potentieller Mensch steckt. Nele Pollatscheks Strohmann-Argument, dass nämlich ungeborenes Leben nur dann Schutz verdient, wenn auch männliche Samen Lebensschutz erhalten, ist hinfällig.
Es gäbe durchaus andere Bibeltexte, die davon sprechen, dass ungeborene Kinder Lebensschutz verdienen. Wie wäre es mit Jeremia 1,5, wo Gott zu dem Propheten spricht: „Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker.“ Oder Psalm 139,13–16, in dem der König David ausspricht, dass seine Erschaffung im Mutterleib ein Grund dafür ist, Gott als den Schöpfer zu loben:
Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war.
Übrigens: Der Artikel von Frau Dr. Pollatschek ist wirklich seelenlos. Sie schlägt vor, dass in Deutschland in die Forschung für Uterus-Transplantationen investiert wird und dann in Zukunft die Männer, die gegen Schwangerschaftsabbrüche sind, sich eine Gebärmutter anschaffen und als Trans-Frauen potentielles Leben austragen dürfen: „Sollte die Forschung bei Transplantationen von Gebärmüttern in trans Frauen erfolgreich sein, könnten sich auch xy-chromosomale Schwangerschaftsabbruchsgegner für das Austragen potenziellen Lebens zur Verfügung stellen. Das wäre ein guter Kompromiss.“
Diesem seelenlosen Geplär setzte ich – auch wenn ich mich wiederhole – Bonhoeffers kluge Stellungnahme entgegen (Ethik, Werkausgabe, Bd. 6, S. 203–204):
Mit der Eheschließung ist die Anerkennung des Rechtes des werdenden Lebens verbunden, als eines Rechtes, das nicht in der Verfügung der Eheleute steht. Ohne die grundsätzliche Anerkennung dieses Rechtes hört eine Ehe auf Ehe zu sein und wird zum Verhältnis. In der Anerkennung aber ist der freien Schöpfermacht Gottes, der aus dieser Ehe neues Leben hervorgehen lassen kann nach seinem Willen, Raum gegeben. Die Tötung der Frucht im Mutterleib ist Verletzung des dem werdenden Leben von Gott verliehenen Lebensrechtes. Die Erörterung der Frage, ob es sich hier schon um einen Menschen handele oder nicht, verwirrt nur die einfache Tatsache, daß Gott hier jedenfalls einen Menschen schaffen wollte und daß diesem werdenden Menschen vorsätzlich das Leben genommen worden ist. Das aber ist nichts anderes als Mord. Daß die Motive, die zu einer derartigen Tat führen, sehr verschiedene sind, ja daß dort, wo es sich um eine Tat der Verzweiflung in höchster menschlicher oder wirtschaftlicher Verlassenheit und Not handelt, die Schuld oft mehr auf die Gemeinschaft als auf den Einzelnen fällt, daß schließlich gerade an diesem Punkt Geld sehr viel Leichtfertigkeit zu vertuschen vermag, während bei den Armen auch die schwer abgerungene Tat leichter ans Licht kommt, dies alles berührt unzweifelhaft das persönliche, seelsorger[liche] Verhalten gegenüber dem Betroffenen ganz entscheidend, es vermag aber an dem Tatbestand des Mordes nichts) zu ändern. Gerade die Mutter, der dieser Entschluß zum Verzweifeln schwer wird, weil er gegen ihre eigenste Natur geht, wird die Schwere der Schuld am wenigsten leugnen wollen.