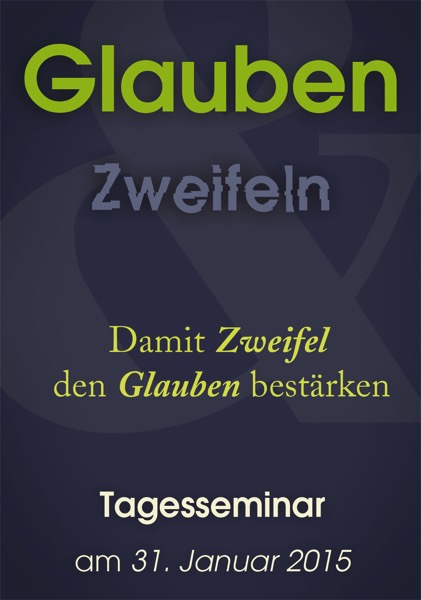Apologetik ist eine systematisch-theologische Disziplin, die den Gläubigen dabei hilft, den in 1Petr 3,15 formulierten Auftrag in die Tat umzusetzen. Apologetik ist demnach denkerische Rechtfertigung und Verteidigung der christlichen Hoffnung. Ihren besonderen Charakter gewinnt die Apologetik dadurch, dass sie Fragen (und Klagen) Andersdenkender aufgreift und für diese formal nachvollziehbar zu beantworten sucht. Petrus erwartet von den Christen, dass sie den Grund für ihre Hoffnung vernünftig kommunizieren können. Ein Apologet glaubt nicht nur, er kann auch erklären und begründen, warum und woran er glaubt. Ein Apologet versucht plausibel darzulegen, warum ein Christ Christ ist und Nicht-Christen Nachfolger von Jesus Christus werden sollten.
Nachfolgend möchte ich einige Gefahren ansprechen, denen ein Apologet erliegen kann:
(a) Mangelnde Authentizität. Es fällt auf, dass Petrus uns in 1Petr 3,5 nicht dazu auffordert, besonders viel zu lesen oder außergewöhnlich klug zu sein. Obwohl wir solche Imperative erwarten würden, formuliert der Apostel ganz andere, nämlich ethische Anliegen. Er erwartet von uns, dass wir uns nicht fürchten (V. 14), dass wir Christus in unseren Herzen heiligen (V. 15), dass wir ein gutes Gewissen haben und mit unseren Nächsten freundlich umgehen (V. 16).
Beim Umgang mit unseren ungläubigen Freunden zählt nicht nur das, was wir sagen, sondern auch das, was wir sind und tun. Wenn unser Leben dem, was wir verkündigen, nicht entspricht, dann benehmen wir uns heuchlerisch. Das griechische Wort für Heuchler (griech. hypokrit̄es) bedeutet so viel wie „Schauspieler sein“, jemandem etwas vormachen. Wir alle stehen also erstens in der Gefahr, uns und anderen etwas vorzuspielen. Selbst für Petrus, dem wir den Auftrag zur nicht-geheuchelten Apologetik zu verdanken haben, kämpfte sein Leben lang mit dem Problem der Heuchelei (vgl. Gal 2,11–14). Auch wenn Apologetik denkerische Rechtfertigung ist, soll sie durch einen überzeugenden Lebensstil gedeckt sein (1Petr 3,16). Skeptiker und Kritiker sollen erkennen können, dass Christen ihren Überzeugungen gemäß leben, auch wenn sie dadurch Nachteile in Kauf nehmen müssen (1Petr 3,17).
(b) Falsche Vereinnahmung. Christen mit einem „apologetischen Herzen“ beschäftigen sich in der Regel gründlich mit dem Denken ihrer ungläubigen Freunde. Auch wenn das nötig ist, stehen sie damit in der Gefahr, von anderen Weltbildern vereinnahmt zu werden. Das sich Einlassen auf anderes Denken kann anfechten und verführen. Viele Irrlehren wurden in die Welt gesetzt, weil Lehrer der Kirche ihren Hörern zu weit entgegengekommen sind (wie uns der kirchengeschichtliche Rückblick gezeigt hat). Bei dem „sich Einlassen“ auf philosophische Denkvoraussetzungen muss Apologetik der Gefahr widerstehen, christliche Positionen inhaltlich mit jeweils prominenten zeitgeistlichen Strömungen zu versöhnen. Christliche Apologetik bezeugt und begründet ja gerade die Wahrheit des Evangeliums gegenüber anderen Wahrheitsansprüchen. Wenn sie durch andere Weltbilder verschluckt wird, verliert sie ihre Kraft und Vollmacht (vgl. „doppeltes Hören“ bei John Stott).
(c) Phantomapologetik. Beim Studium apologetischer Literatur findet man gelegentlich Widerlegungen von Positionen, die so gar nicht vertreten werden. Die gegnerische Argumentation wird also vom Apologeten in einer Weise entwickelt, dass sie sich gut widerlegen lässt. Gott erwartet allerdings von uns auch Sorgfalt, Treue und Fairness bei der Darstellung von Positionen, die uns nicht gefallen. Wir helfen niemandem weiter, wenn wir uns auf die schwachen Argumente der Gegner konzentrieren. Untersuchen wir die stärksten Einwände unserer Kritiker in einer Art, die der „Goldenen Regel“ angemessen ist (vgl. Lk 6,31).
(d) Lieblose Rechthaberei. So wie wir aus dem Motiv der Liebe heraus biblische Lehre kompromittieren können, stehen wir schließlich drittens in der Gefahr, lieblos und stolz aufzutreten. Wir können Diskussionen und Debatten gewinnen und gleichzeitig Hörer verlieren. Erkenntnis bläht auf, Liebe baut auf (vgl. 1Kor 8,1). Achten wir also darauf, dass wir unseren Gesprächspartnern respektvoll und freundlich begegnen. Apologetik tritt nicht rechthaberisch oder aggressiv auf, sondern „sanftmütig“ und „ehrerbietend“ (1Petr 3,15c). Sie ist Liebesdienst. Das Verstehen Andersdenkender erfordert neben echtem Interesse und viel Zeit auch Demut, daher die Bereitschaft, sich, um einen anderen zu verstehen, unter ihn zu stellen („understanding“, das engl. Wort für „verstehen“, bringt diesen Sachverhalt gut zum Ausdruck). Wir wollen nicht Argumente, sondern Seelen gewinnen.
Ein Christ hat außerdem nicht auf alle Fragen eine Antwort, sondern kann nur dort Gottes Botschaft vertreten, wo Gott sich in seinem Wort geoffenbart hat (vgl. den Kommentar von J. Calvin zu 1Petr 3,15 auf S. 87). Gottes Gebot und die Menschengebote der jeweiligen religiösen Tradition und Kultur werden von Jesus und Paulus strikt auseinandergehalten (z. B. Mk 7,1–15; 1Kor 9,19–23). Der Apologet und Missionar darf nicht mit dem Anspruch auftreten, in allem die Wahrheit zu kennen und zu vertreten, sondern kann als fehlbarer Mensch nur dort von einem Ausschließlichkeitsanspruch sprechen, wo Gott ihm dies in seinem Wort geboten hat. Die Bibel selbst spricht davon, dass wir weder Gottes Gedanken noch die Welt exhaustiv verstehen können. Für Paulus ist die Menschwerdung Gottes ein Mysterium (1Tim 3,16). Gottes Handeln wird von ihm auch als unbegreiflich und unausforschlich beschrieben (Röm 11,33). Unser Begreifen bleibt bruchstückhaft (1Kor 13,9), die Gedanken Gottes sind höher als unsere Versuche, diese Gedanken nachzudenken (vgl. Jes 55,8–9).
Unser Gegenüber muss also mit seinem Schöpfer versöhnt werden, nicht mit uns. Deswegen können wir demütig immer wieder zurücktreten, unsere eigene Begrenztheit und Unzulänglichkeit zugeben und deutlich darauf verweisen, dass wir dem anderen gegenüber nur insofern Autorität beanspruchen können, als wir unverfälscht und für ihn verständlich die Frohe Botschaft verkündigt haben. Die Ehrerbietung ist eine Folge davon, dass wir Menschen mit Gottes Augen sehen, also als seine Geschöpfe, als Ebenbilder Gottes.
(e) Hochmut. Christen leben von der Gnade Gottes, weshalb Paulus im Epheserbrief schreibt: „Denn durch die Gnade seid ihr gerettet aufgrund des Glaubens, und zwar nicht aus euch selbst, nein, Gottes Gabe ist es: nicht durch eigenes Tun, damit niemand sich rühmen kann“ (Eph 2,8–9). Gotteserkenntnis und die Liebe zu Gott sind Geschenk, nicht verdiente Leistung. Christen sind weder klüger oder besser informiert als Ungläubige, noch sind sie ihnen moralisch überlegen. Bernhard Ramm schreibt korrekt (B. Ramm, Ein christlicher Appel an die Vernunft, 1972, S. 122):
„Christen, die von sich behaupten, über eine sichere Gotteserkenntnis zu verfügen, werden sich als erste von allen Überlegenheitsallüren distanzieren. Gott hat ihnen ihre geistliche Gewißheit aus Gnade zukommen lassen, und die Gnade gibt keinen Anlaß, sich zu rühmen (vgl. Römer 3,27ff).“

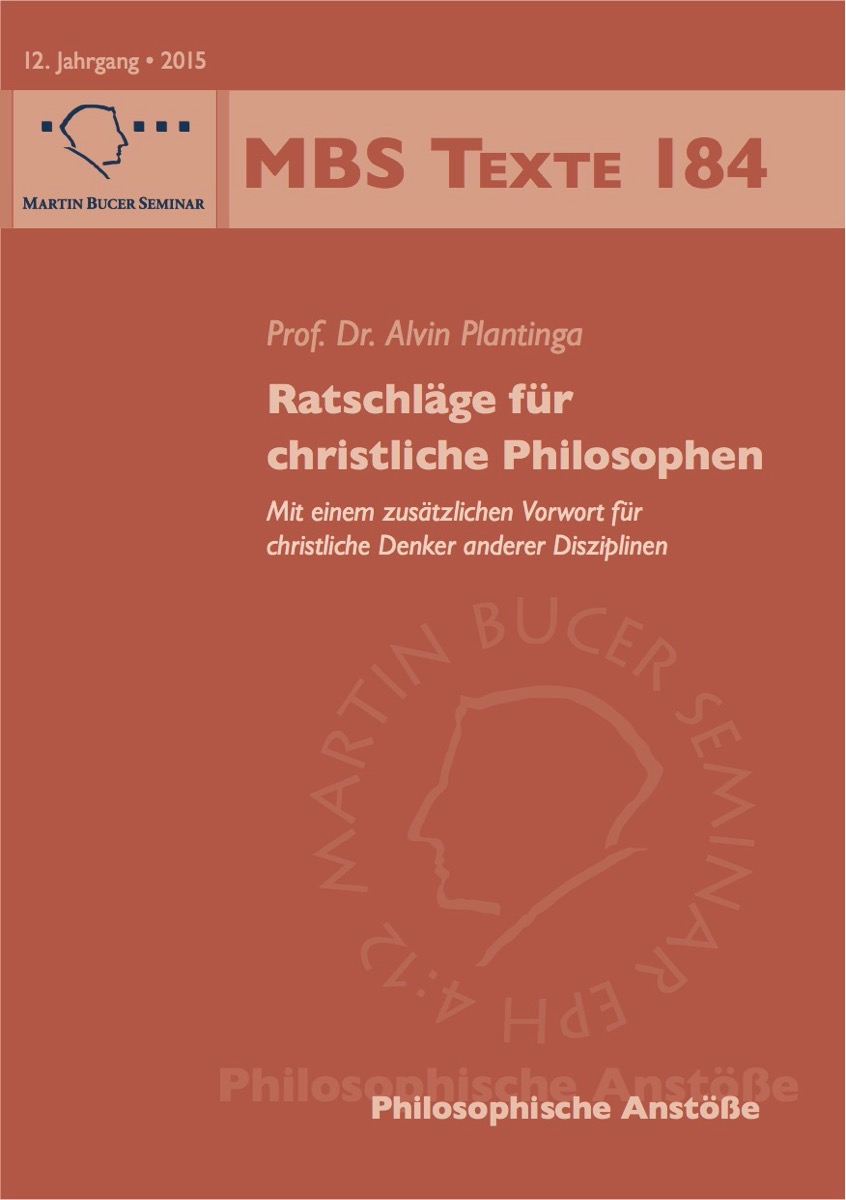 Vor 30 oder 35 Jahren war die öffentliche Stimmung der etablierten Mainstream-Philosophie in der englischsprachigen Welt zutiefst unchristlich. Wenige etablierte Philosophen waren Christen, noch weniger waren bereit, in der Öffentlichkeit zuzugeben, dass sie es seien, und sogar noch weniger dachten von ihrem Christsein, dass es für ihre Philosophie einen echten Unterschied machen würde. Die am weitesten verbreitete Frage der philosophischen Theologie zu jener Zeit war nicht, ob das Christentum oder der Theismus wahr seien, stattdessen war die Frage, ob es überhaupt Sinn mache, zu sagen, dass es eine Person wie Gott gebe. Dem logischen Positivismus zufolge, der damals überall sein Unwesen trieb, macht der Satz „Es gibt eine Person wie Gott“ buchstäblich keinen Sinn; er sei verkappter Unsinn; er drücke nicht einmal irgendeinen Gedanken oder eine Proposition aus. Die zentrale Frage war nicht, ob der Theismus wahr ist; es ging darum, ob es überhaupt so etwas wie den Theismus gibt – eine echte, sachliche Proposition, die entweder wahr oder falsch ist. Aber die Dinge haben sich geändert. Es gibt jetzt viel mehr Christen im professionellen Umfeld der Philosophie in Amerika, sogar viel mehr unerschrockene Christen.
Vor 30 oder 35 Jahren war die öffentliche Stimmung der etablierten Mainstream-Philosophie in der englischsprachigen Welt zutiefst unchristlich. Wenige etablierte Philosophen waren Christen, noch weniger waren bereit, in der Öffentlichkeit zuzugeben, dass sie es seien, und sogar noch weniger dachten von ihrem Christsein, dass es für ihre Philosophie einen echten Unterschied machen würde. Die am weitesten verbreitete Frage der philosophischen Theologie zu jener Zeit war nicht, ob das Christentum oder der Theismus wahr seien, stattdessen war die Frage, ob es überhaupt Sinn mache, zu sagen, dass es eine Person wie Gott gebe. Dem logischen Positivismus zufolge, der damals überall sein Unwesen trieb, macht der Satz „Es gibt eine Person wie Gott“ buchstäblich keinen Sinn; er sei verkappter Unsinn; er drücke nicht einmal irgendeinen Gedanken oder eine Proposition aus. Die zentrale Frage war nicht, ob der Theismus wahr ist; es ging darum, ob es überhaupt so etwas wie den Theismus gibt – eine echte, sachliche Proposition, die entweder wahr oder falsch ist. Aber die Dinge haben sich geändert. Es gibt jetzt viel mehr Christen im professionellen Umfeld der Philosophie in Amerika, sogar viel mehr unerschrockene Christen.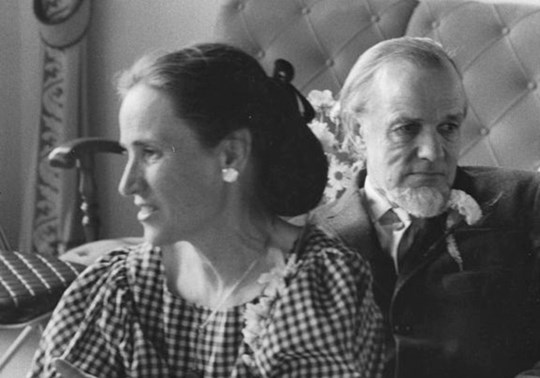 Gewöhnlich führen wir die Debatten um die Vertrauenswürdigkeit der Heiligen Schrift im Eiffelturm theologischer Seminare. Dabei sind es die existentiell herausfordernden Momente, in denen unsere Theologie sich bewährt oder nicht bewährt. Am 15. Mai 1984 starb der christliche Apologet Francis Schaeffer. Seine Witwe Edith, beschrieb später den Trost, den sie in jenen schweren und einsamen Stunden seines Todes empfing. Sie wurde getröstet, weil sie der biblischen Zusage des ewigen Lebens vertrauen konnte.
Gewöhnlich führen wir die Debatten um die Vertrauenswürdigkeit der Heiligen Schrift im Eiffelturm theologischer Seminare. Dabei sind es die existentiell herausfordernden Momente, in denen unsere Theologie sich bewährt oder nicht bewährt. Am 15. Mai 1984 starb der christliche Apologet Francis Schaeffer. Seine Witwe Edith, beschrieb später den Trost, den sie in jenen schweren und einsamen Stunden seines Todes empfing. Sie wurde getröstet, weil sie der biblischen Zusage des ewigen Lebens vertrauen konnte.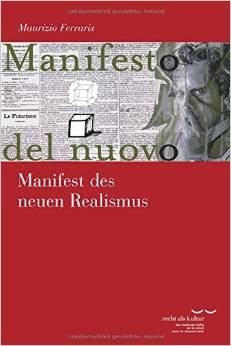 Mit zwei neuen geisteswissenschaftlichen Strömungen, dem „Neue Realismus“ und dem „Spekulative Realismus“, kehrt das Absolute nun allmählich zurück. Unter dem Dekonstruktionsdrang der postmodernen Denkkultur ist ihrer Meinung nach die wirkliche Welt zu einer Fabel geworden (M. Ferraris,
Mit zwei neuen geisteswissenschaftlichen Strömungen, dem „Neue Realismus“ und dem „Spekulative Realismus“, kehrt das Absolute nun allmählich zurück. Unter dem Dekonstruktionsdrang der postmodernen Denkkultur ist ihrer Meinung nach die wirkliche Welt zu einer Fabel geworden (M. Ferraris,  Der Postmodernismus ist aus der Überzeugung erwachsen, „dass alles Wesentliche oder überhaupt alles konstruiert sei – von der Sprache, von den Begriffsschemata, von den Medien“ (M. Ferraris, „Was ist der neue Realismus?“, in: M.,
Der Postmodernismus ist aus der Überzeugung erwachsen, „dass alles Wesentliche oder überhaupt alles konstruiert sei – von der Sprache, von den Begriffsschemata, von den Medien“ (M. Ferraris, „Was ist der neue Realismus?“, in: M.,  Die Kultur des „anything goes“, die sowieso nur in einigen elitären Zirkeln und im Medienpopulismus zelebriert wird, erfährt also eine Umwandlung. Das neue Denken richtet sich wieder stärker an einer vorgegebenen Wirklichkeit aus. Die realistischen Strömungen rehabilitieren die durch den Postmodernismus verwischte Unterscheidung zwischen dem, was es gibt (Ontologie) und jenem, was wir erkennen (Epistemologie).
Die Kultur des „anything goes“, die sowieso nur in einigen elitären Zirkeln und im Medienpopulismus zelebriert wird, erfährt also eine Umwandlung. Das neue Denken richtet sich wieder stärker an einer vorgegebenen Wirklichkeit aus. Die realistischen Strömungen rehabilitieren die durch den Postmodernismus verwischte Unterscheidung zwischen dem, was es gibt (Ontologie) und jenem, was wir erkennen (Epistemologie).