Was ist die Verheißung der Hoffnung?
Mark Dever schreibt in: Der große Plan (Waldems: 3L Verlag, 2014, S. 64–65):
Was ist denn die Verheißung der Hoffnung, auf die das Volk Gottes im Alten Testament schauen kann? Es ist klar, dass seine Hoffnung nicht in der eigenen Geschichte liegen konnte. Es war eine Geschichte des ständigen Versagens!
Diese Hoffnung konnte auch nicht im Opfersystem liegen. Ein Psalmist sagte dazu: „Opfer und Gaben hast du nicht gewollt; Ohren aber hast du mir bereitet“ (Ps 40,7). Das bedeutet, Gott hat den Psalmdichter zu seinem Eigentum gemacht. Die Autoren des Alten Testaments verstehen offensichtlich, was auch der Autor des Hebräerbriefs schrieb:„Denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen [Heils]-güter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit den gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Hätte man sonst nicht aufgehört, Opfer darzubringen, wenn die, welche den Gottesdienst verrichten, einmal gereinigt, kein Bewusstsein von Sünden mehr gehabt hätten? Stattdessen geschieht durch diese [Opfer] alle Jahre eine Erinnerung an die Sünden. Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinweg nehmen“ (Hebr 10,1-4).
Ein endlos wiederholendes Opfern kann die Menschen nicht vollkommen machen. Das Blut von Stieren und Böcken kann die Sünde nicht hinweg nehmen. Wo liegt dann in alledem die Hoffnung?
Um die Antwort auf dieser Frage zu finden, müssen wir zurückkehren zu 2Mose 34, wo das Rätsel des Alten Testament steht. Erinnern sie sich daran, dass wir die Frage stellten, wie Gott sowohl „Schuld, Übertretung und Sünde“ vergeben, als auch die Schuldigen „keineswegs ungestraft [lassen]“ kann? Schließlich verdienen Sie und ich Gottes Strafe. Selbst wenn Sie sich für außerordentlich tugendhaft halten, da sie aufmerksam einer Predigt über das ganze Alte Testament zuhörten! Wir sind alle schuldig vor Gott. Und in 2Mose 34 verspricht Gott, dass er unsere Sünde keineswegs ungestraft lassen wird. Also welche Hoffnung gibt es?
Wir haben schon gesagt, dass Sühnung das Leiden und den Tod eines unschuldigen Ersatzes benötigt. Wir haben aber auch angedeutet, dass mehr als der Tod eines Tieres benötigt wird, um dies zu erreichen. Irgendeine Beziehung zwischen Opfer und Schuldigem muss existieren. Es braucht eine weit engere Beziehung als die, die zwischen uns und einem nicht nach Gottes Ebenbild geschaffenen Tier möglich ist.
Wir werden die Antwort zu dem alttestamentlichen Rätsel, das den Israeliten und auch uns gestellt wird, nicht in uns selbst oder bei einem Tier finden. Sowohl ihre Hoffnung als auch unsere muss sich in der verheißenen Person des Alten Testaments finden …
Die Menschen zurzeit Jesu fragten sich nicht, ob ein Messias kommen würde. Für sie war es selbstverständlich, dass ihre einzige Hoffnung in dem „Gesalbten“ Gottes lag. Doch als dieser Gesalbte kam, waren alle überrascht von der Art seines Kommens. Jesus stellte sich selbst nicht nur als die Erfüllung der alttestamentlichen Prophetien des königlichen Messias vor, sondern er erfüllte auch eine Menge von anderen Verheißungen.
 Die großen Fragen des Lebens sind in den Augen vieler Menschen Fragen der Wirtschaft. Ökonomen erklären nicht nur, wie die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen entsteht und gedeckt werden kann oder warum es Arbeit, Kapital, Preise und Steuern gibt. Sie sagen auch manchmal Krisen voraus oder zetteln revolutionäre Umbrüche an. Große Wirtschaftsdenker wollen eben die Welt nicht nur deuten, sondern sie auch – wenigstens ein bisschen – verbessern.
Die großen Fragen des Lebens sind in den Augen vieler Menschen Fragen der Wirtschaft. Ökonomen erklären nicht nur, wie die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen entsteht und gedeckt werden kann oder warum es Arbeit, Kapital, Preise und Steuern gibt. Sie sagen auch manchmal Krisen voraus oder zetteln revolutionäre Umbrüche an. Große Wirtschaftsdenker wollen eben die Welt nicht nur deuten, sondern sie auch – wenigstens ein bisschen – verbessern.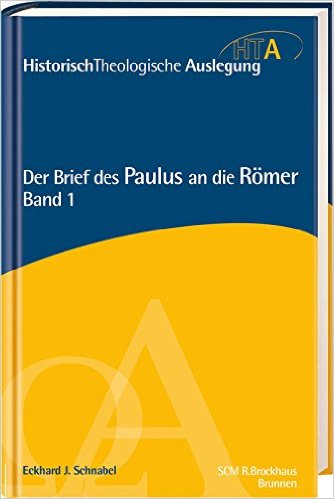
 Ryan Hoselton schreibt in: „Ein zeitgemäßes Vorbild Der Abolitionist William Wilberforce und die Lebensrechtsbewegung heute“:
Ryan Hoselton schreibt in: „Ein zeitgemäßes Vorbild Der Abolitionist William Wilberforce und die Lebensrechtsbewegung heute“: Die neue Ausgabe von Glauben & Denken heute ist erschienen. Inhalt der Ausgabe 2/2015:
Die neue Ausgabe von Glauben & Denken heute ist erschienen. Inhalt der Ausgabe 2/2015: