Wie sind wir hier gelandet? Der Siegeszug des modernen Selbst
Vor ein paar Wochen habe ich mit Oliver Last über die Spätmoderne und den Siegeszug des modernen Selbst geplaudert. Das Ergebnis kann man in einer Folge des Leaders Podcast hören:
Vor ein paar Wochen habe ich mit Oliver Last über die Spätmoderne und den Siegeszug des modernen Selbst geplaudert. Das Ergebnis kann man in einer Folge des Leaders Podcast hören:
Der kanadische Religionsphilosoph Charles Taylor hat in seinem Buch Das säkulare Zeitalter den Begriff „Soziales Vorstellungsschema“ entwickelt. Er beschreibt damit Überzeugungen, Verhaltensweisen, normativen Erwartungen und unbewussten Annahmen, die Angehörige einer Gesellschaft teilen und die ihren Alltag prägen. Zusammengefasst ist das soziale Vorstellungsschema die Art und Weise, wie Menschen sich die Welt vorstellen und intuitiv in ihr handeln.
Wie deutlich sich das Soziale Vorstellungsschema in den letzten Jahren auch in kirchlichen Kreisen gewandelt hat, offenbart ein frischer Text aus der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW). Martin Fritz geht dort der Frage nach, was „rechte Christen“ sind und wie man mit ihnen umgehen soll. Kurz: Wer die Sexuelle Revolution für eine Fehlentwicklung hält, wer für das Lebensrecht eintritt, wer gelebte Homosexualität nicht bejaht, wer die Verflüssigung von Geschlechtszuschreibungen und Geschlechterrollen (vgl. Judith Butler) ablehnt, ist laut Fritz im Netz einer rechtschristlichen Anti-Haltung gefangen. Wörtlich schreibt er:
Die Basis rechtschristlicher Anti-Haltung ist ein umfassendes Krisenbewusstsein. Die Protagonisten leiden an den kulturellen Wandlungen, die sie oftmals mit dem Symboljahr „1968“ verbinden und als allgemeinen „Linksruck“ beschreiben. Sexuelle Revolution, Straffreiheit von Abtreibung, Legalisierung und Akzeptanz der Homosexualität (bis hin zur „Homo-Ehe“), Verflüssigung von Geschlechtszuschreibungen und Geschlechterrollen („Genderismus“) – der Umbruch in diesen sexual- und genderethischen Fragen wird von vielen als „Kulturbruch“ empfunden. Hinzu kommen die ethnisch-kulturellen Verschiebungen durch die „Masseneinwanderung“, gerade aus mehrheitlich muslimischen Ländern, aber auch die Transformationswirkungen von globalisiertem Kapitalismus und technischem Fortschritt, die in der Wahrnehmung vieler eine geistentleerte Kultur der Zerstreuung und des Konsumismus hervorgebracht haben. Die öffentlich und mit Nachdruck erhobenen Forderungen radikalen Umdenkens und Umsteuerns in Fragen der Vergangenheitsaufarbeitung und Diskriminierungsprävention (Postkolonialismus, „Wokismus“, Gendersprache) sowie des Umwelt- und Klimaschutzes („Ökologismus“) werden schließlich von nicht wenigen als bedrohliche Eingriffe in ihre bewährten Selbstverständnisse und Lebensgewohnheiten erlebt.
Nun enthalten diese Behauptungen ja nichts Neues. Bezeichnend für den Wandel des Soziales Vorstellungsschemas ist die Tatsache, dass diese Zuschreibungen, die wir seit Jahren aus der FRANKFURTER RUNDSCHAU oder TAZ kennen, aus der EZW stammen.
Die EZW ist die Nachfolgeorganisation der Apologetischen Centrale, die nach dem Ersten Weltkrieg durch Innere Mission in Berlin gegründet wurde. Geleitet wurde sie viele Jahre von Walter Künneth (1901–1997). Künneth hat den Einsatz für das Lebensrecht, die historische christliche Sexualethik und die binäre Geschlechterordnung als wesensmäßig für den christlichen Glauben verstanden. Auch wenn er Vorbehalte gegenüber den Ideen einer „Schöpfungsordnung“ oder dem „Naturrecht“ hegte (weil er hier die Auswirkungen der Sünde zu wenig berücksichtigt fand), trat er doch entschieden für eine göttliche „Erhaltungsordnung“ ein, die der Kirche in der Botschaft der Heiligen Schrift anvertraut ist.
Aus der Sicht von Martin Fritz sind „ordnungstheologische Figuren“, egal, wie sie letztlich genannt werden, bereits Kennzeichen eines „rechten Christseins“ und damit Verirrungen. Es werden weltliche Vorstellungsschemata herangezogen, um christliches Denken und Leben zu dekonstruieren.
[#ad]
Der kanadische Philosoph Charles Taylor wird heute 90 Jahre alt. Christian Geyer würdigt ihn mit dem Artikel „Zauber der Vernunft“ (FAZ, 05.11.2021, Nr. 258, S. 13). Zwei Zitate:
Warum Taylor zu den großen Säkularisierungs-Theoretikern gehört, hat damit zu tun, dass er die Frage nach Gott modernekritisch einfach umdrehte. Nicht nach Art von Substraktionstheorien wollte er die Moderne denken, also nicht so, dass der Mensch sich erst seiner Transzendenzen entledigt hätte, bevor er das Licht der Vernunft erblickt. Sondern umgekehrt erklärte Taylor die Transzendenzlosigkeit zu einer Schwundstufe der Vernunft, zur Minus-Vernunft.
…
Die Verleugnung der Transzendenz oder besser: den Verlust ihrer Selbstverständlichkeit macht Taylor verantwortlich für die liberalistischen Fehlentwicklungen der Moderne. Von diesem Verlust her erkennt er ein Versiegen von moralischen Quellen, ohne welche das Selbst- und Weltverständnis des Menschen defizitär bleibe, wie er in seinem Hauptwerk „Quellen des Selbst. Die Entstehung der neuzeitlichen Identität“ darzulegen suchte. Es ist dieser religionsphilosophische Kern, um den herum Taylor seine Anthropologie baute, über Jahrzehnte in etlichen Büchern und Aufsätzen entfaltete, dabei durchgängig den psychologischen Behaviorismus als Fehlanzeige brandmarkend. „Wie wollen wir leben?“ – diese bewusst voluntaristisch formulierten, vom aufgeklärten Individuum her gestellte Frage nimmt die Sinnfrage in die eigene Regie.
Charles Taylors Buch Ein säkulares Zeitalter hilft zu verstehen, dass unsere moderne Gesellschaft sich den „selbstgenügsamen Humanismus“ einverleibt hat. „Unter ‚Humanismus‘“, so Taylor, „verstehe ich in diesem Zusammenhang eine Einstellung, die weder letzte Ziele, die über das menschliche Gedeihen hinausgehen, noch Loyalität gegenüber irgendeiner Instanz jenseits des Gedeihens akzeptiert. Diese Beschreibung trifft auf keine frühere Gesellschaft zu” (Ein säkulares Zeitalter, 2009, S. 41).
Mit anderen Worten: Unsere Nachbarn und Mitmenschen finden Sinn und Bedeutung des Lebens nicht in irgendetwas jenseits der unmittelbaren Erfahrungswelt, jenseits von Erfolg, Sex, Macht, Karriere und Beziehungen. Gleichzeitig ist jedoch ein „Unbehagen“ inmitten dieses selbstgenügsamen Humanismus zu beobachten. Taylor schreibt:
Hier kann leicht das Gefühl aufkommen, daß wir etwas verpassen, von etwas abgeschnitten sind oder hinter einem Schutzschirm leben. […] Ich denke dabei eher an ein allgemeines Unbehagen an der entzauberten, als fade und leer wahrgenommenen Welt und an ein vielgestaltiges Suchen nach etwas Innerem oder Jenseitigem, das den zusammen mit der Transzendenz verlorengegangenen Sinn wettmachen könnte. (Ein säkulares Zeitalter, 2009, S. 512)
John Starke hat in seinem Beitrag „Predigen in einem säkularen Zeitalter“ herausgearbeitet, inwiefern uns die Einsichten Taylors helfen können, spätmodernen Menschen das Evangelium auf eine Weise zuzusprechen, dass sie den Reichtum Christi besser verstehen. Denn die Botschaft der Bibel hat dem Selbstverständnis der Menschen in der erschöpften Moderne etwas entgegenzusetzen:
Das Christentum ist ganz anders. Zwar rühmt sich auch das Christentum der Schwäche (siehe Apostel Paulus), aber es macht das Ich fähig (anders als nur authentisch) für Veränderung und Transformation. Das authentische Ich spricht: „So bin ich, du musst mich so akzeptieren, wie ich bin.“ Das verwundbare Ich spricht: „So bin ich, nimm mich und verändere mich.“ Das verwundbare Ich kommt nicht nur in der Form des Bekenntnisses, sondern auch der Buße. Es sucht nicht nach dem Ich, um Macht und Zustimmung zu bekommen, sondern göttliche Hilfe und Errettung.
Hier mehr: www.evangelium21.net.
Nachfolgend eine Rezension zu dem Buch (zuerst erschienen in Glauben und Denken heute, 1/2020, Nr. 25, S. 69–71):

Gerhard Kardinal Müller, von 1982 bis 2002 Professor für Dogmatik an der Universität München, von 2002 bis 2012 Bischof von Regensburg und von 2012 bis 2017 Präfekt der Kongregation für Glaubenslehre, ist einer der bedeutendsten katholischen Denker der Gegenwart. Viele nicht-katholische Theologen kennen ihn durch seine Dogmatik, die inzwischen in zehn Auflagen bei Herder erschienen und in mehrere Sprachen übersetzt worden ist. Der kürzlich verstorbene Neutestamentler Klaus Berger, der übrigens nach eigener Aussage bis 1995 kein Lehrbuch der Systematischen Theologie besessen hat, bezeichnete das Lehrwerk als „ein didaktisch gelungenes Buch“ mit „gediegenen Informationen, die stets das Wesentliche bieten“ (FAZ, 12.04.1995, Nr. 87, S. 11). Ich greife genau aus diesen Gründen gern auf das kompakte Lehrbuch zurück. Entsprechend groß waren meine Erwartungen, als ich mit der Lektüre von Der Glaube an Gott im säkularen Zeitalter begonnen habe.
Der Band geht auf Vorlesungen sowie frühere Beiträge, die aktualisiert wurden, zurück. Auf Einladung der Katholischen Universität Lublin in Polen unterrichtete Kardinal Müller vom 7. bis 21. Oktober 2018 für Hörer aller Fakultäten. Viele Studenten und Professoren erbaten im Anschluss die hier besprochene Veröffentlichung, die übrigens nicht als systematisches Lehrbuch oder geschlossene Monographie verstanden werden darf (vgl. S. 19–20). In einer Zeit, in der der Glaube nur noch ein Angebot unter anderen ist, möchte Müller zu zentralen Fragen und neuralgischen Punkten Stellung nehmen. Er schreibt dabei auch als Seelsorger, der die Fragen und Nöte der Menschen kennt (vgl. S. 22).
Müller trägt seine Apologetik auf der Grundlage der katholischen Gnaden- und Erkenntnislehre vor, wie wir sie eingängig etwa bei Thomas von Aquin finden. Er steht methodisch also in der Schuld Aristoteles’, dessen Philosophie „ihrem Wesen nach nicht heidnisch, also vom Götterglauben durchdrungen, sondern vernünftig und darum geeignet“ ist, „sich argumentativ mit der durch die Vernunft erfassten Wirklichkeit von Mensch, Welt und Gott auseinanderzusetzen“ (S. 291).
Da der thomistische Ansatz bei der Behandlung konkreter Sachverhalte vorausgesetzt wird, sei er kurz skizziert: Unser Wissen von Gott kann nicht aus der Gottesidee logisch deduziert und damit rationalisiert werden. Wir können uns aber durch die Vernunft der Existenz Gottes versichern und sie vermittels seiner Wirkungen argumentativ darstellen, wenn er sich „im ‚Gleichnis des Seins‘ durch die Werke der Schöpfung (Röm 1,10 [vermutlich Röm 1,20, Anm. R. K.]) und im Urteilsspruch des Gewissens (Röm 2,16 [vermutlich Röm 2,15, Anm. R. K.])“ kundtut, ohne „dass er sein Wesen und Sein kund macht, so dass er mittels der Begriffsbildung unter die Herrschaft einer endlichen Vernunft geraten und somit verdinglicht werden könnte“ (S. 62–63). „Dem Glauben des Menschen an Gott geht die Liebe Gottes zu ihm voraus, die unser Herz öffnet und den Geist empfänglich macht, so dass der Glaube an Gott im Menschen nichts weniger als die antwortetende Liebe ist“ (S. 64). Der Mensch erkennt den sich offenbarenden Gott nicht „kraft des eigenen Lichts seines natürlichen Denkvermögens (lumen naturale), sondern durch das eingegossene Licht des Glaubens (lumen fidei)“ (S. 64). Wir Menschen können also mit der Vernunft die Welt denkend erkennen und durchdringen. Gotteserkenntnis braucht hingegen die Unterstützung von „Gnade und Offenbarung“, die quasi die natürliche Reichweite unendlich steigert (vgl. S. 64). Die Aufgabe der Theologie ist es, die „innere Vernünftigkeit aufzuzeigen, die sich aus der Selbstmitteilung Gottes als ‚Gnade und Wahrheit‘ (Joh 1,17) ergibt, um zum rechten Handeln in Kirche und Welt anzuleiten“ (S. 65). Versuche, den Glauben rationalistisch, also mit der natürlichen Vernunft begründen zu wollen, bedeuteten nur, den christlichen Glauben „dem Spott der Ungläubigen auszusetzen“ (S. 65–66). „Der Glaubende ist gehalten, jedem der nach dem Logos des Glaubens fragt (1Petr 3,15), eine rationale Antwort (= Apo-Logia) zu geben und Schwierigkeiten seiner freien Annahme zu überwinden. Der Glaube bleibt aber frei und kann nicht durch Vernunftgründe logisch erzwungen werden oder rationalistisch ad absurdum geführt werden. Der theologale Glaube ist von Seiten Gottes ein Geschenk seiner Gnade; aber von Seiten des Menschen eine Sache des freien Willens – credere est voluntatis“ (S. 289). Die natürliche Vernunft erkennt maximal, dass Gott ist. Wer Gott ist, kann aus dem Seienden nicht erschlossen werden. Kardinal Müller beruft sich hier auf Gedanken, die Dietrich Bonhoeffer in seiner Habilitationsschrift Akt und Sein (1931) geäußert hat: „Einen Gott, den ‚es gibt‘, gibt es nicht; Gott ‚ist‘ im Person-bezug, und das Sein ist sein Personsein“ (S. 67–68). Die Offenbarung Gottes durch Jesus Christus in seinem Wort geht über die Wirkungen der Schöpfung hinaus und vermittelt uns Menschen diese personale Beziehung zu Gott dank der inneren Kraft des Heiligen Geistes (vgl. S. 67).
Von diesen Voraussetzungen ausgehend nähert sich Müller nun den verschiedenen Anfragen, mit denen der christliche Glauben im säkularen Zeitalter konfrontiert wird. Wenn er vom säkularen Zeitalter spricht, dann bezieht er sich vor allem auf die Analyse des kanadischen Philosophen Charles Taylor, nach der der Glaube nicht mehr die alles bestimmende Wirklichkeit, sondern nur eine Option ist.1 „Gott darf im öffentlichen Leben, im Staat und allen Kulturinstitutionen, den Wissenschaften, dem öffentlichen Recht, der Moral, der Wirtschaft und Politik, der Schule und Erziehung, der Kunst und Literatur nicht mehr vorkommen. Er gilt nicht mehr fraglos als gemeinsamer Bezugspunkt der Wirklichkeitserschließung und Lebensbewältigung“ (S. 96).
Kardinal Müller erörtert insgesamt 20 Themen. Der Band wird mit einem Beitrag über Polen, ein Land, das die Freiheit liebt und einen christlichen Humanismus hervorgebracht hat, eröffnet. Es folgen Kapitel über die Gotteslehre, die kirchliche Tradition, die Selbstsäkularisierung des Christentums, Glaube und Vernunft, die Dreieinigkeitslehre, die Theodizee und so fort. Er kritisiert Atheismus, Posthumanismus, Relativismus und die Genderideologie. Stellenweise deckt der Kardinal den totalitären Anspruch atheistischer oder positivistischer Strömungen rigoros auf: „Gegenwärtig erleben wir im ‚Westen‘ eine neue Phase der De-Christianisierung von Gesellschaft, Kultur, der Wissenschaften, Erziehung und den Medien. Sie wird vorangetrieben durch demokratisch nicht legitimierte überstaatliche Organisationen“ (S. 371). Gleich anschließend schreibt er:
Der nihilistische Atheismus hat unübersehbare Konsequenzen für das im Glauben an Gott den Schöpfer und Erlöser gründende christliche Menschenbild. Wo er sich als Staatsideologie und in kämpferischen Atheistenclubs unter den [sic!] Slogan ‚Religion ist Privatsache‘ die Vernichtung der Kirche Christi oder ihre Marginalisierung zum erklärten Ziel gesetzt hat, bewirbt er sich als neuer selbsterlöserischer Humanismus im Namen von Vernunft und Wissenschaft, Freiheit und Fortschritt in der Technik. Sein Ziel ist die restlose Kontrolle über die Natur und die Gesellschaft und über die Sprache und die innersten Gedanken und das Gewissen jedes einzelnen und aller Menschen. Wir stehen in einer totalen Gesinnungsdiktatur, wie sie die Welt noch nicht kannte oder lückenlos durchsetzen konnte. (S. 372)
Stark ist sein Verweis auf das Selbstmissverständnis, dass jede Theologie oder Epoche der Theologiegeschichte „sich der jeweils vorherrschenden philosophischen Richtung oder einem Systemdenker kritiklos“ anschließt (S. 310). Der Mahnung, dass ein Theologe die Welt in Kultur und Wissenschaft nicht sich selbst als „Raum des Unglaubens und der Gottlosigkeit“ überlassen darf, werden viele christliche Sozialethiker gern zustimmen (S. 366). Brillant auch die – aus seiner Sicht von Thomas herkommende – Überzeugung, dass nicht nur konkrete Evidenzen säkularen Denkens beantwortet werden müssen, sondern auch ihre Entstehungszusammenhänge auszuloten sind: Die Theologie „muss vielmehr die soziologischen und intellektuellen Bedingungen des Geisteslebens der modernen Welt in den Blick nehmen, um aus ihnen heraus den Zugang zur Tatsache der Selbsterschließung Gottes in Jesus Christus als das Heil jedes Menschen offenzuhalten. (S. 368)
Wer das Buch Der Glaube an Gott im säkularen Zeitalter genau liest, wird freilich schnell merken, dass der Titel eigentlich für „Der katholische Glaube an Gott im säkularen Zeitalter“ steht. Die vorgetragene Apologetik richtet sich nämlich nicht nur gegen gottlose Denkwege, sondern fernerhin gegen die Theologie der Reformation. Das folgende Zitat ist dafür programmatisch:
Die reformatorischen Formal- und Materialprinzipien (solus Christus, sola fide et gratia, sola scriptura) erfassen das Gott-Menschverhältnis dialektisch als eine Widerspruchs-Einheit auf [sic.]. Die katholische Theologie geht von einer analogen Vermittlung aus, so dass Vernunft und Glaube, Natur und Gnade, menschliche Empfänglichkeit und göttliche Gabe eher als Synthese gedacht werden, die in der Annahme der menschlichen Natur durch das göttliche Wort ihr tragendes Fundament und das Prinzip ihres Erkenntniswerdens hat. Die Analogia entis ist die Voraussetzung der Analogia fidei. Daraus ergibt sich das katholische et-et; aber in der unumkehrbaren Reihenfolge: Christus und die Kirche, Glaube und Vernunft, Gnade und Sakramente, Gottesliebe und Nächstenliebe (gute Werke). (S. 402)
Die Apologetik der katholischen Theologie blitzt da auf, wo Gerhard Müller die Heiligenverehrung verteidigt (S. 58) oder unter Berufung auf Stefan Zweig dem Genfer Reformator Johannes Calvin vorwirft, die grausame Hinrichtung des Miguel Serveto betrieben zu haben (vgl. S. 36–37). Müllers Sicht auf Calvin verwundert, hat doch die Forschung bereits vor vielen Jahren nachgewiesen, dass Zweig Castellio gegen Calvin in agitatorischer Absicht verfasste und Calvin nicht der Hauptverantwortliche für die Hinrichtung von Serveto war.2
Die weitreichende Differenz zwischen katholischer und protestantischer Apologetik tritt vor allem dort offen zutage, wo Müller herausstreicht, dass nach katholischer Ursündenlehre die Fähigkeiten der natürlichen Vernunft nicht gravierend betroffen sind, auch nicht im Blick auf den theologischen Horizont der Ontologie, also „der Erkenntnis der Existenz Gottes durch die natürliche Vernunft“ (S. 312). Hier grenzt er sich drastisch von der reformatorischen Erkenntnislehre ab, nach der die menschliche Vernunft keinen Weg zu Gott findet, da sie selbst erlösungsbedürftig ist. Reformatorische Theologie deutet den Menschen nicht als ein Geschöpf, das seinen Schöpfer sehnsüchtig sucht und ihn hören will (vgl. dagegen S. 74), sondern als „Feind Gottes“ (Röm 5,10; Kol 1,21; Eph 2,16) und „Gotthasser“ (Röm 1,30). Der Mensch lebt im Stand der Sünde eben nicht im neutralen Raum auf die Gnade wartend, sondern im aktiven Widerspruch gegen Gott. Es braucht einen göttlichen Eingriff, der ihn in die Krise stürzt und zugleich zu neuem Leben erweckt.
Gerhard Kardinal Müller hat mit Der Glaube an Gott im säkularen Zeitalter einen respektablen Sammelband zur Fundamentaltheologie vorgelegt. Er formuliert seine Argumente erwartungsgemäß präzise und glänzt stellenweise mit seiner Kritik des Zeitgeistes. Dass er als ehemaliger Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre ein durch und durch katholisches Buch geschrieben hat, wird ihm niemand vorwerfen. Vor allem katholische Christen werden daher gern auf das Buch zurückgreifen. Protestanten können von der Lektüre ebenfalls profitieren, da es solide und aktuell in die konfessionelle Fundamentaltheologie einführt und die Unterschiede zwischen thomistischer und reformatorischer Verteidigung des Glaubens veranschaulicht.
 Kaum ein Buch, das in den letzten zehn Jahren veröffentlicht wurde, hat sich so ehrgeizige Ziele gesetzt wie Charles Taylors Werk Ein säkulares Zeitalter. Taylor versucht darin nicht weniger, als die Ausbreitung des Säkularismus und die Krise des Glaubens in den letzten 500 Jahren schlüssig zu erklären. Der Verlag stellt das Buch – übrigens 1299 Seiten – mit den Worten vor:
Kaum ein Buch, das in den letzten zehn Jahren veröffentlicht wurde, hat sich so ehrgeizige Ziele gesetzt wie Charles Taylors Werk Ein säkulares Zeitalter. Taylor versucht darin nicht weniger, als die Ausbreitung des Säkularismus und die Krise des Glaubens in den letzten 500 Jahren schlüssig zu erklären. Der Verlag stellt das Buch – übrigens 1299 Seiten – mit den Worten vor:
Was heißt es, daß wir heute in einem säkularen Zeitalter leben? Was ist geschehen zwischen 1500 – als Gott noch seinen festen Platz im naturwissenschaftlichen Kosmos, im gesellschaftlichen Gefüge und im Alltag der Menschen hatte – und heute, da der Glaube an Gott, jedenfalls in der westlichen Welt, nur noch eine Option unter vielen ist?
Um diesen Wandel zu bestimmen und in seinen Folgen für die gegenwärtige Gesellschaft auszuloten, muß die große Geschichte der Säkularisierung in der nordatlantischen Welt von der frühen Neuzeit bis in die Gegenwart erzählt werden – ein herkulisches Unterfangen, dem sich der kanadische Philosoph Charles Taylor in seinem mit Spannung erwarteten neuen Buch stellt. Mit einem Fokus auf dem „lateinischen Christentum“, dem vorherrschenden Glauben in Europa, rekonstruiert er in geradezu verschwenderischem Detail die entscheidenden Entwicklungslinien in den Naturwissenschaften, der Philosophie, der Staats- und Rechtstheorie und in den Künsten. Dem berühmten Diktum von der wissenschaftlich-technischen „Entzauberung der Welt“ und anderen eingeschliffenen Säkularisierungstheorien setzt er die These entgegen, daß es die Religion selbst war, die das Säkulare hervorgebracht hat, und entfaltet eine komplexe Mentalitätsgeschichte des modernen Subjekts, das heute im Niemandsland zwischen Glauben und Atheismus gefangen ist.
In einem Sammelband haben nun Autoren und Theologen wie Collin Hansen, Michael Horton, Brett McCracken, Jen Pollock Michel, Carl Trueman Charles Taylors Thesen untersucht und sich gefragt, was sie für die Kirchen und die Mission bedeuten. Das erste Kapitel des Buches kann hier heruntergeladen werden. Das Cover wurde übrigens von Peter Voth gestaltet (ein Interview mit Peter gibt’s hier). Herzlichen Glückwunsch!
Das Buch Our Secular Age: Ten Years of Reading and Applying Charles Taylor kann hier bestellt werden.
Der Katholik Charles Taylor, emeritierter Professor für Philosophie aus dem kanadischen Montreal, gehört zu den bedeutendsten zeitgenössischen Religions- und Sozialphilosophen. In seinem Opus Magnum setzt er sich mit der Religion im Zeitalter des Säkularismus auseinander und plädiert für Säkularisierung und öffentliche Religion.
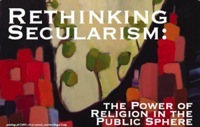 Am 22. Oktober kam es zu einem Zusammentreffen von Judith Butler, Charles Taylor, Cornel West und Jürgen Habermas. Das Symposium »Rethinking Secularism: the Power of Religion in the Public Sphere« bot folgende Vorträge an:
Am 22. Oktober kam es zu einem Zusammentreffen von Judith Butler, Charles Taylor, Cornel West und Jürgen Habermas. Das Symposium »Rethinking Secularism: the Power of Religion in the Public Sphere« bot folgende Vorträge an:
Mitschnitte der Vorträge können hier gehört werden: blogs.ssrc.org.
Interessant fand ich eine Diskussion zwischen dem Agnostiker Jürgen Habermas und dem Kommunitarist Charles Taylor. Eine (allerdings sehr schlechte) Tonaufnahme davon sowie eine Transkription gibt es hier: blogs.ssrc.org.