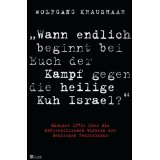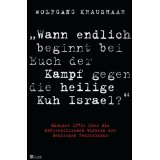 Der Freiburger Rundbrief, eine Zeitschrift für christlich-jüdische Begegnung, hat freundlicherweise erlaubt, hier eine Rezension von Bettina Klix wiederzugeben. Die Autorin Bettina Klix hat das Buch:
Der Freiburger Rundbrief, eine Zeitschrift für christlich-jüdische Begegnung, hat freundlicherweise erlaubt, hier eine Rezension von Bettina Klix wiederzugeben. Die Autorin Bettina Klix hat das Buch:
besprochen (Jahrgang 20 / 2013 Heft 4, S. 309–311).
Hier:
„Wann endlich beginnt bei Euch der Kampf gegen die heilige Kuh Israel?“
Der Politikwissenschaftler Wolfgang Kraushaar will sich einfach nicht abfinden mit dem Vergessen und der Ungeklärtheit von antisemitischen Verbrechen in Deutschland. Sein Buch „Die Bombe im jüdischen Gemeindehaus“ (2005) führte sogar zur Klärung eines versuchten Sprengstoffanschlags am 9. November 1969 in Berlin. Die Terrorserie, die er mit diesem Buch rekonstruiert, hat eine ganz andere Dimension. Ihr mörderisches Herz ist der Brandanschlag auf das Altenheim der israelitischen Kultusgemeinde in München am 13. Februar 1970 mit sieben Toten – alle Überlebende des Holocaust.
In einem Artikel in der Welt vom 23. März 2013 antwortete Kraushaar auf die teils heftige Kritik von linker Seite an diesem Buch. Er beginnt mit der Erinnerung daran, was für ihn das besonders Unerträgliche an jenem Münchner Verbrechen ist, das 2012 durch den Dokumentarfilm „München 1970. Als der Terror zu uns kam“ (Regie Georg M. Haffner) ins Gedächtnis gerufen wurde:
„Das Wort Holocaust stammt aus dem Griechischen, heißt ‚vollständig verbrannt’ und meinte in der Antike ursprünglich das Brandopfer von Tieren. Seit der Ausstrahlung des gleichnamigen Fernsehfilms im Januar 1979 hat sich im deutschen Sprachraum durchgesetzt, diesen Ausdruck als Bezeichnung für die von den Nazis organisierte Massenvernichtung der Juden zu verwenden.“
Der Münchner Anschlag aber habe auf grausame Weise diese Verbrechen sozusagen zitiert und gleichzeitig an sieben Überlebenden das Werk vollendet.
Kraushaars übergenaue Studie ist auch eine bitter notwendige Geschichtsstunde über Versäumnisse des Staates. Die Lektion beginnt mit der Erinnerung an den Überfall eines Palästinenser-Kommandos auf die israelische Olympiamannschaft 1972. Das Grauenhafte ist, dass diese Entführung und ihr blutiges Ende hätten verhindert werden können. Wenn aus der Terrorwelle, die in den zwei Jahren davor München erschütterte, die richtigen Schlüsse gezogen worden wären, hätte sich das Sicherheitskonzept der Spiele danach ausrichten müssen. Diese Zeit des Terrors ist so gut wie vergessen. Nur ihr Höhepunkt, der sich vor den Augen der Weltöffentlichkeit abspielte, ist in Erinnerung geblieben.
Gegen dieses Vergessen schreibt Kraushaar mit diesem Buch geradezu verzweifelt an. Und wir Leser möchten auch verzweifeln angesichts dessen, was er aufdeckt, ohne die Schuldigen fassen zu können. Ein Verbrechen aufzuklären gelingt ihm diesmal nicht, und er erhebt auch nicht den Anspruch. Aber der Versuch einer Ausleuchtung aller bekannten Umstände soll dennoch so ausführlich wie möglich sein. Es werden gerade auch Mentalitäten geschildert, die uns heute nicht mehr gegenwärtig sind. Wie kam es, dass die deutsche Linke ihre Haltung gegenüber Israel so radikal änderte, bis hin zu jener unerträglichen Position, die der Titel des Buches ausspricht: „Wann endlich beginnt bei Euch der Kampf gegen die heilige Kuh Israel?“
Der Satz entstammt einem Brief von Dieter Kunzelmann. Nach der Ausbildung in einem Lager der Fatah heimlich nach Deutschland zurückgekehrt, hatte er 1970 in einem fiktiven „Brief aus Amman“ seine deutschen Genossen ermahnt, zu Taten überzugehen:
„Von Amman aus frage ich mich: wann endlich beginnt bei Euch der organisierte Kampf gegen die heilige Kuh Israel? Wann entlasten wir das kämpfende palästinensische Volk durch praktischen Internationalismus?“
Der Historiker Moishe Postone hat in seinem Buch „Deutschland, die Linke und der Holocaust“ (2005) auf die Gründe für die fatale Verkehrung hingewiesen:
„Keine westliche Linke war vor 1967 in dem Maße philosemitisch und prozionistisch wie sie nach dem Sechs-Tage-Krieg propalästinensisch war. Was ‚Antizionismus’ genannt wurde, war in Wirklichkeit so emotional und psychisch beladen, dass es weit über die Grenzen einer politischen und gesellschaftlichen Kritik am Zionismus hinausging. Das bloße Wort war so negativ besetzt wie Nazismus […].
Der Wendepunkt vom Philosemitismus zu jener Form des Antizionismus war der Krieg 1967. Ich vermute, dass hier ein Prozess psychologischer Umkehr stattfand, in dem die Juden als Sieger mit der Nazivergangenheit identifiziert wurden, – positiv durch die deutsche Rechte, negativ von der Linken. Umgekehrt wurden die Opfer der Juden, nämlich die Palästinenser, als Juden identifiziert. Es ist in dieser Hinsicht bemerkenswert, dass der Auslöser für eine solche Wende nicht die Vertreibung und das Leiden der Palästinenser war, das schon lange vor 1967 begonnen hatte, sondern der siegreiche ‚Blitzkrieg’ der Israelis.“
Und wie argumentieren diejenigen, die die deutschen Stadtguerilleros in ihrem „Volksbefreiungskrieg“ unterstützen wollen? In einem Interview mit dem Stern 1970 gab der Chef der AOLP (Aktionsorganisation zur Befreiung Palästinas) Dr. Issam El-Sartaoui bereitwillig Einblick in sein Denken:
„Die Deutschen haben 3,5 Milliarden Mark Wiedergutmachung an Israel gezahlt. Westdeutschlands finanzielle und technische Unterstützung Israels war ein wesentlicher Faktor für die Entwicklung der israelischen Kriegsmaschine. […] Wir sind nicht gegen die Wiedergutmachung der Naziverbrechen an den Juden. Im Gegenteil, das war die Pflicht des deutschen Volkes. […] Aber die Aufrüstung Israels richtet sich gegen uns. Auf diese Weise kann Westdeutschland sich rühmen, in einer Generation zwei Völkermorde begangen zu haben. Den Völkermord an den Juden und – durch die überlebenden Juden – den Völkermord an den Arabern.“
Kraushaar schreibt dazu:
„Selbst seiner terroristischen Logik mangelt es nicht an argumentativer Kraft. Er weiß offenbar nur zu genau, welche Punkte er betonen muss, um die Schwachstellen in der Legitimationslogik der Bundesrepublik zu treffen.“
Und diese schwachen Punkte waren mitentscheidend für die verhängnisvolle Appeasementpolitik dieser Jahre, die dazu führte, dass man sich im Rahmen einer „neuen Nahostpolitik“ zahlloser schon gefasster palästinensischer Terroristen durch Abschiebung entledigte, um nicht erpressbar zu werden. Zum 40. Jahrestag des Olympiaanschlags schrieb der Spiegel, damals habe „der Geist des ‚Appeasement’ die Bonner Amtsstuben durchweht“. Und da München die Stadt des ersten Appeasement gewesen sei, als die Westmächte 1938 glaubten, Hitler beschwichtigen zu können, war dies für Israel eine ganz besonders grausame Ironie der Geschichte.
Kraushaar zeigt, dass weder die staatliche Seite der Verantwortung noch die Verstrickung der Linken aufgearbeitet ist. Sein Schlusswort entfernt sich weit von der Schuldzuweisung. Er erinnert an ein Wort von Bundespräsident Heinemann, der 1968 nach dem Attentat auf Rudi Dutschke und den folgenden Unruhen mit zwei Toten und unzähligen Verletzten erklärt hatte:
„Wer mit dem Zeigefinger allgemeiner Vorwürfe auf den oder die vermeintlichen Anstifter oder Drahtzieher zeigt, sollte daran denken, dass in der Hand mit dem ausgestreckten Zeigefinger zugleich drei andere Finger auf ihn selbst zurückweisen.“
Damit sei zunächst wohl die Schuldzuweisung an das Zeitungsimperium von Axel Springer gemeint gewesen, das die Aufhetzung bewirkt habe. Aber Kraushaar findet, dass hier ein übertragbares Bild gefunden ist, das
„geeignet [ist], jene Zusammenhänge besser zu begreifen, die zu den schrecklichen Ereignissen des Februar 1970 geführt haben. Nichts wird die Schuld palästinensischer Terroristen und ihrer deutschen Unterstützer mindern können. Es könnte jedoch ein Fehler sein, die Verantwortung für die damals begangenen Verbrechen allein bei ihnen zu suchen.“
Bettina Klix, Berlin