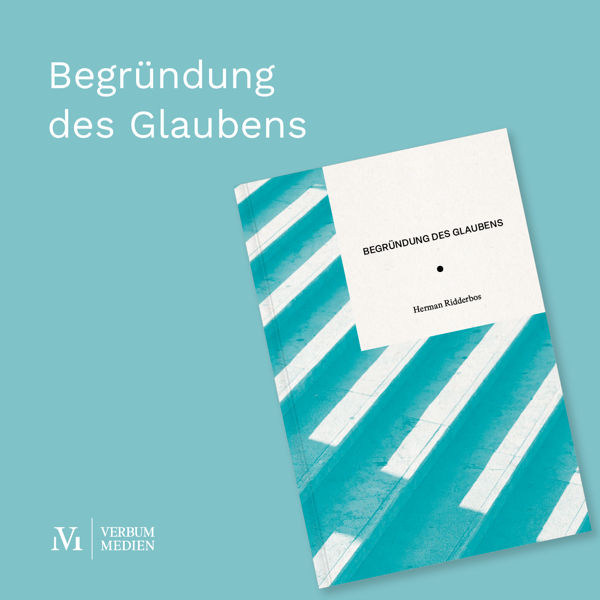
Die gerade erschienene Neuauflage des Buches Begründung des Glaubens (Verbum Medien, 2025) des Neutestamentlers Herman Ridderbos erschien erstmalig 1955 als Heilsgeschiedenis en Heilige Schrift van het Nieuwe Testament. Es folgten drei englischsprachige Auflagen mit dem Titel Redemptive History and the New Testament Scriptures in einem presbyterianischen Verlag. Sowohl die niederländische als auch die englischen Ausgaben enthalten einen zweiten Teil über die Autorität des Neuen Testaments, der in der deutschen Ausgabe von 1963 leider fehlt. Bei der Neuauflage haben wir daher nicht nur die alte Übersetzung an einigen Stellen erheblich überarbeitet, sondern auch den bisher fehlenden zweiten Teil über die Autorität des Neuen Testaments übersetzt und eingefügt.
Worum geht es in diesem Buch?
Ridderbos geht es in Begründung des Glaubens nicht – wie man aufgrund des Titels vermuten könnte – um die Verteidigung der christlichen Religion. Er erörtert vielmehr die Frage, mit welchem Recht der christliche Glaube Offenbarungswahrheit in Anspruch nimmt. Er diskutiert die Bedeutung der Schrift, ihre Kanonizität und die Eigenart ihrer Autorität.
Für den Leser ist es hilfreich, zu wissen, dass die Arbeit in einer Zeit entstand, in der es sehr verbreitet war, den biblischen Schriften lediglich einen menschlichen Zeugnischarakter zuzugestehen (vgl. z.B. Karl Barth o. Emil Brunner). Demnach komme der Bibel selbst keine Offenbarungsqualität zu, da sie nur ein menschliches und damit gebrechliches Zeugnis der göttlichen Offenbarung sei. Aus diesem Grund stand der kritischen Arbeit am „Schriftzeugnis“ nichts im Weg, was folglich die Kanonkritik und allgemein die historisch-kritische Forschung am Neuen Testament rechtfertigte und beflügelte.
Herman Ridderbos greift die vielfältigen damit zusammenhängenden Fragestellungen auf und legt schließlich eine eigenständige Antwort vor. Er vertritt die Auffassung, dass die Autorität des Kanons weder in der Anerkennung des Kanons durch die Kirche noch in der Erfahrung des Gläubigen mit dem Kanon liegt. Jeder Versuch, die Autorität des Kanons mit anderen Mitteln als dem Kanon selbst zu begründen, öffnet nach Ridderbos einer subjektivistischen und willkürlichen Argumentation Tür und Tor. Ebendeswegen ist für Ridderbos der neutestamentliche Kanon selbst die Offenbarung Gottes für sein Volk, da er die verbindliche schriftliche Verkündigung der Worte und Taten Gottes in Christus darstellt, die durch die göttlich beauftragten Apostel kundgetan wurden. Als solcher gehört der Kanon zum Heilshandeln Gottes in der Geschichte und erhält genau hierdurch seine bindende Autorität.
Das klingt dann so:
Zunächst erscheint es etwas gewaltsam, eine Verbindung zwischen Heilsgeschichte und neutestamentlichem Kanon herstellen zu wollen. Es ist ja nirgendwo im Neuen Testament von einem Kanon als abgeschlossener Einheit von Schriften die Rede. An keiner Stelle hören wir von einem Auftrag, bestimmte Schriften zusammenzustellen, die der Kirche auf ihrem Weg durch die Geschichte als Richtschnur dienen sollen. Der Kanon ist – so scheint es jedenfalls – dem Heilshandeln Gottes in Jesus Christus a posteriori hinzugefügt. Er kam erst dann zum Zuge, als die großen Heilstaten Gottes, die Fleischwerdung Jesu Christi, seine Auferstehung, die Himmelfahrt, die Ausgießung des Heiligen Geistes schon längst der Vergangenheit angehörten. So betrachtet ist es nicht verwunderlich, dass sich die gegenwärtige Literatur – die auf den historischen Charakter der neutestamentlichen Offenbarung so starken Nachdruck legt – so wenig mit der Bedeutung beschäftigt, die das Neue Testament als literarische Größe in diesem Heilshandeln einnimmt. Es scheint wirklich so, als ob die Heilige Schrift des Neuen Testaments erst nach der großen Offenbarungszeit auftrete und sie deswegen in der Kirchengeschichte behandelt und dementsprechend beurteilt werden müsse. Doch ist dies nur zum Teil wahr. Gewiss gehört die Festlegung des Kanons als abgeschlossene Einheit von 27 Büchern zur Kirchengeschichte. Die Frage ist aber, ob das auch ob das auch vom Kanon in qualitativem Sinne gilt; genauer gesagt: ob dasjenige, was die Kirche veranlasst hat, einen schriftlichen und geschlossenen Kanon als Norm des Glaubens anzuerkennen, seinen Grund nur in der Geschichte der Kirche selbst oder auch in der Heilsgeschichte findet. Es geht hierbei nicht um das Wort „Kanon“, das im Neuen Testament nur wenige Male vorkommt und dort in sehr allgemeiner Form. Es geht um die sachliche Autorität, die den in den Kanon aufgenommenen Schriften von Anfang an in der Kirche zuerkannt wurde und die dann auch – vor allem im Westen – den kirchlichen Gebrauch des Namens „Kanon“ im Sinne von „Maßstab, Regel, Norm für Glaube und Leben“ bestimmt hat.
Von dieser Autorität gilt, dass sie ihren Ursprung im Herzen der Heilsgeschichte hat. Es ist die Tat Jesu Christi selbst, die hierin sichtbar wird, und das nicht allein deswegen, weil er als der Gesandte des Vaters und als der Sohn Gottes Träger göttlicher Vollmacht war und man daher sagen kann, dass Gott sich in Christus der Welt gegenüber als Kanon erwiesen hat. Tatsächlich hat Christus zur Mitteilung und Überlieferung dessen, was in der „Fülle der Zeit“ geschehen ist, was gesehen und gehört wurde, die formale Autoritätsinstanz geschaffen, auf die sich Ursprung und Maßstab des Evangeliums für alle Zukunft gründet.
Das Buch kostet 12,90 € und kann bei Verbum Medien oder überall im Buchhandel bestellt werden.
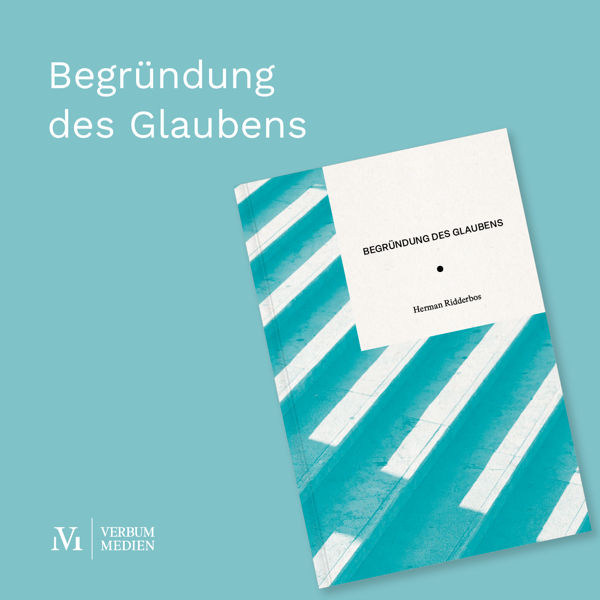
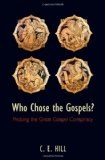 Soeben ist ein weiteres Buch zur Entstehung des neutestamentlichen Kanons erschienen. Craig Blomberg schreibt über:
Soeben ist ein weiteres Buch zur Entstehung des neutestamentlichen Kanons erschienen. Craig Blomberg schreibt über: