 Wer heutzutage aufwächst, gehört zu den sogenannten »digital natives«. Das heißt, für Kinder, Jugendliche und viele junge Erwachsene ist eine Welt ohne umspannendes Datennetz und »social networking« gar nicht mehr vorstellbar. Zweifellos profitieren viele Jugendliche von den neuen medialen Möglichkeiten, aber es wird auch vor Nebenwirkungen gewarnt: Übermäßiger Medienkonsum halte von anderen Freizeitaktivitäten und körperlicher Bewegung ab und könne die Gesundheit bedrohen. Auch gibt es einen Zusammenhang zwischen Gewaltmedien und Aggression. Bedenklich stimmt zudem die Freizügigkeit vieler jungen Leute beim Umgang mit persönlichen Daten im Internet.
Wer heutzutage aufwächst, gehört zu den sogenannten »digital natives«. Das heißt, für Kinder, Jugendliche und viele junge Erwachsene ist eine Welt ohne umspannendes Datennetz und »social networking« gar nicht mehr vorstellbar. Zweifellos profitieren viele Jugendliche von den neuen medialen Möglichkeiten, aber es wird auch vor Nebenwirkungen gewarnt: Übermäßiger Medienkonsum halte von anderen Freizeitaktivitäten und körperlicher Bewegung ab und könne die Gesundheit bedrohen. Auch gibt es einen Zusammenhang zwischen Gewaltmedien und Aggression. Bedenklich stimmt zudem die Freizügigkeit vieler jungen Leute beim Umgang mit persönlichen Daten im Internet.
Die jüngste Ausgabe der Beilage zur Wochenzeitschrift Das Parlament ist dem Thema »Jugend und Medien« gewidmet. Das Themenheft ist gelungen. Ich bin mit einigen Schlussfolgerungen nicht einverstanden, kann aber Eltern, Lehrern, Pastoren und vor allem Leuten aus der Jugendarbeit die Lektüre empfehlen. Die vermittelten Einblicke in die Datenbasis und Problemfelder können dabei helfen, eigene Antworten zu finden.
Zwei besondere Empfehlungen:
Ingrid Möller untersucht den Zusammenhang von »Gewaltmedien und Aggression« und kommt zu folgendem Fazit:
Über die potenziell aggressionsfördernde Wirkung des regelmäßigen Konsums gewalthaltiger Medieninhalte wird in der Öffentlichkeit intensiv diskutiert, wobei das Spektrum der vertretenen Positionen von der monokausalen Verursachung extremer Gewalttaten, etwa von Amokläufen an Schulen, bis hin zur Leugnung jedweder Beziehung zwischen Gewaltkonsum und Aggressionsbereitschaft reicht. Dieser Beitrag hat einerseits gezeigt, dass es mittlerweile eine Vielzahl von Belegen für einen Zusammenhang zwischen Gewaltkonsum und Aggression gibt und die vermittelnden Prozesse, insbesondere der Erwerb aggressiver Verhaltensdrehbücher und die emotionale Abstumpfung, zunehmend klarer hervortreten. Andererseits ist aber auch deutlich geworden, dass der Konsum gewalthaltiger Medien nur einer von vielen Faktoren ist, die mit aggressivem Verhalten in Beziehung stehen oder es gar kausal bestimmen.
Die nachgewiesenen Effektstärken sind von moderater Größenordnung, und die Frage, welche anderen Variablen in der Personoder dem sozialen Umfeld die Effekte des Gewaltkonsums verstärken oder mindern können, ist noch nicht hinreichend geklärt. Offen ist auch die Frage der möglicherweise unterschiedlichen Wirkkraft von Gewalt in Filmen und Gewalt in Spielen. Die wenigen Einzelstudien, die hierzu bislang vorliegen, zeichnen noch kein klares Bild. Weiteren Forschungsbedarf gibt es im Hinblick darauf, welches Wirkpotenzial verschiedene Darstellungsformen oder neue Techniken haben (z. B. Gewaltspiele auf Konsolen wie etwa der »Wii«, die durch körperliche Bewegung gesteuert werden).
Angesichts der weltweiten Verbreitung gewalthaltiger Medien und der hohen Nutzungsintensität gerade im Jugendalter ist die Größenordnung der Effekte allerdings als bedeutsam anzusehen und wirft die Frage nach wirksamen Interventionsansätzen auf.
Margreth Lünenborg, Professorin für Kommunikationswissenschaft, schreibt über »Gezielte Grenzverletzungen – Castingshows und Werteempfinden«.
In Castingshows, allen voran »Deutschland sucht den Superstar«, werden Provokationen von Jugendlichen bis zu einem gewissen Grad nicht nur toleriert, sondern mit Vergnügen verfolgt. Sie bieten ihnen einen diskursiven Raum, im dem die jugendliche Sehnsucht nach Grenzüberschreitungen gegenüber Konventionen der Erwachsenenwelt gefahrlos ausgelebt werden kann.
Die Programmproduzenten reagieren offenkundig auf eben dieses Nutzungsinteresse. Insbesondere bei »DSDS« finden sich Grenzüberschreitungen und Tabubrüche, die vor allem männliche Jugendliche dazu einladen, Regeln der Erwachsenenwelt gefahrlos zu brechen. Jugendliche artikulieren voyeuristische Sehlust, insbesondere an verbalen Entgleisungen im Rahmen von Castingshows. Sie folgen bei ihrer moralischen Bewertung der dramaturgischen Erzählstruktur der Formate, die Provokationen als konstitutiven Bestandteil rechtfertigen.
APuZ 3/2011 (17. Januar 2011) kann hier heruntergeladen werden: LOT0MN.pdf.
 Der Liedermacher Wolf Biermann ist heute 75 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch!
Der Liedermacher Wolf Biermann ist heute 75 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch!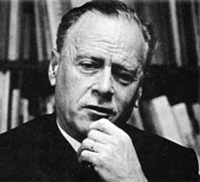
 Wer heutzutage aufwächst, gehört zu den sogenannten »digital natives«. Das heißt, für Kinder, Jugendliche und viele junge Erwachsene ist eine Welt ohne umspannendes Datennetz und »social networking« gar nicht mehr vorstellbar. Zweifellos profitieren viele Jugendliche von den neuen medialen Möglichkeiten, aber es wird auch vor Nebenwirkungen gewarnt: Übermäßiger Medienkonsum halte von anderen Freizeitaktivitäten und körperlicher Bewegung ab und könne die Gesundheit bedrohen. Auch gibt es einen Zusammenhang zwischen Gewaltmedien und Aggression. Bedenklich stimmt zudem die Freizügigkeit vieler jungen Leute beim Umgang mit persönlichen Daten im Internet.
Wer heutzutage aufwächst, gehört zu den sogenannten »digital natives«. Das heißt, für Kinder, Jugendliche und viele junge Erwachsene ist eine Welt ohne umspannendes Datennetz und »social networking« gar nicht mehr vorstellbar. Zweifellos profitieren viele Jugendliche von den neuen medialen Möglichkeiten, aber es wird auch vor Nebenwirkungen gewarnt: Übermäßiger Medienkonsum halte von anderen Freizeitaktivitäten und körperlicher Bewegung ab und könne die Gesundheit bedrohen. Auch gibt es einen Zusammenhang zwischen Gewaltmedien und Aggression. Bedenklich stimmt zudem die Freizügigkeit vieler jungen Leute beim Umgang mit persönlichen Daten im Internet.