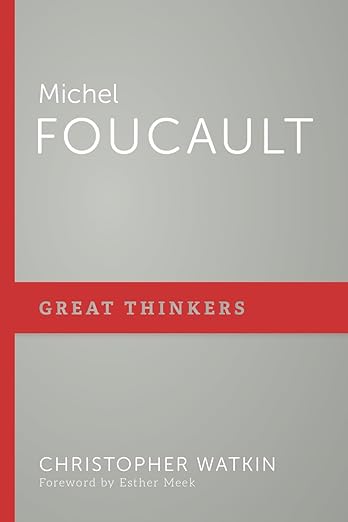Michel Foucault, zumindest der frühe Foucault, fand seine Berufung darin, jene Machtmechanismen zu demaskieren, die überall in der Gesellschaft installiert worden sind, um die Herrschaft der „Bourgeoisie“ abzusichern (oder zu erweitern). Sogar dem Humanismus ging es nach ihm nur darum, die Menschen klein und zahm zu halten. Die Erfindungen des Humanismus waren allesamt dafür da, den einfachen Leuten im Abendland dem Verlangen nach Macht einen Riegel vorzuschieben.
Das Herz des Humanismus ist die Theorie vom Subjekt (im Doppelsinn des Wortes: als Souverän und Untertan). Darum lehnt das Abendland so erbittert alles ab, was diesen Riegel sprengen könnte, wofür es zwei Methoden gibt: die »Entunterwerfung« des Willens zur Macht, d.h. der politische Kampf als Klassenkampf – oder das Unternehmen einer Destruktion des Subjekts als eines Pseudo-Souveräns, d.h. eine »kulturelle« Attacke: Aufhebung der sexuellen Tabus, Einschränkungen und Aufteilungen; Praxis des gemeinschaftlichen Lebens; Aufhebung des Drogenverbots; Aufbrechung aller Verbote und Einschließungen, durch die sich die normative Individualität konstituiert und sichert. Ich denke da an alle Erfahrungen, die unsere Zivilisation verworfen hat oder nur in der Literatur zuläßt. (Michel Foucault, Von der Subversion des Wissens, 1987, S. 95)
Foucault wusste, dass es nicht ausreicht, das Denken der Menschen in andere Bahnen zu lenken. Um die Institutionen zu zerstören, die die Herrschaft der Herrschenden sichern, mussten bestimmte Erfahrungen ermöglicht werden. Es reicht also nicht aus, Bücher verkaufen. Es braucht konkrete Erfahrungen mit Sex, Drogen und dem gemeinschaftlichen Leben, um die herrschende Ordnung zu dekonstruieren und letztlich zu zerstören. Es braucht eine Revolution. Foucault:
Wenn es nur ums Bewußtsein der Leute ginge, so würde es genügen, Zeitschriften und Bücher zu veröffentlichen und Rundfunk- oder Fernsehproduzenten zu gewinnen. Wir aber wollen die Institution angreifen, die in der schlichten und grundlegenden Ideologie gipfelt, welche sich in den Begriffen von Gut und Böse, Unschuld und Schuld ausdrückt. Wir wollen diese gelebte Ideologie in den Institutionen verändern, in denen sie sich konkretisiert und reproduziert. Vereinfacht gesagt: der Humanismus besteht darin, das ideologische System verändern zu wollen, ohne an die Institution zu rühren; der Reformismus besteht darin, die Institution zu verändern, ohne ans ideologische System zu rühren. Die revolutionäre Aktion hingegen definiert sich als gleichzeitige Erschütterung des Bewußtseins und der Institution; dies setzt voraus, daß man zum Angriff auf die Machtverhältnisse übergeht, deren Instrumentarium Bewußtsein und Institution sind. Glauben Sie, daß man die Philosophie und ihren Moralkode in derselben Weise wird lehren können, wenn das Strafrechtssystem eingestürzt ist? (Michel Foucault, Von der Subversion des Wissens, 1987, S. 95)
Der letzte Punkt ist sehr interessant. Foucault wollte nicht nur die Gefängnisse und die psychiatrischen Anstalten abschaffen. Er wollte nicht nur Schülern und Studenten nicht-repressive Erfahrungen mit Drogen und Sexualität ermöglichen. Er wollte das Rechtssystem als solches abschaffen. Er hatte vor, die Gerichte und die Rechtsprechung zu beseitigen und eine proletarische Justiz einzuführen, die auf Richter verzichtet. Als Vorbild diente ihm dabei die Französische Revolution.
Was Foucault wahrscheinlich nicht nur übersieht, sondern bewusst unterschlägt, ist die Tatsache, dass Gesellschaften ohne gute Gesetze und unabhängige Gerichte in den Terror abgleiten, so wie das auch nach der Französischen Revolution geschehen ist.
Roger Scruton hat das sehr schön herausgestellt, so dass ich ihn hier gern zitiere (Narren, Schwindler, Unruhestifter, 2021, S. 166–167):
In einer bemerkenswerten Diskussion mit einer Gruppe Maoisten 1968 zieht Foucault einige politische Konsequenzen aus seiner Analyse des Rechts, als einer weiteren »kapillaren« Form der Macht und einer weiteren Art, »Widersprüche unter den Massen zu schüren«. Die Revolution könne nur stattfinden, versichert er ihnen, »wenn der Rechtsapparat und alles, was zur Wiederherstellung des Strafapparates führen könnte, radikal eliminiert wird, und alles, was seine Ideologie wieder einführen und dieser Ideologie ermöglichen würde, in die alltägliche Praxis wieder einzuschleichen, verbannt wird.« Er befürwortet die Verbannung der Rechtsprechung und sämtlicher Formen von Gerichten und deutet eine neue Form »proletarischer« Justiz an, die auf Richter verzichten kann.
»Die Französische Revolution«, erklärt er, sei »eine Rebellion gegen die Rechtsprechung« gewesen, und dies gehöre zur Natur jeder anständigen Revolution. Hätte er über die historischen Tatsachen gesprochen, über die Revolutionstribunale, in denen Richter, Ankläger und Zeugen ein und dieselbe Person waren, wo der Angeklagte nicht das Recht hatte, zu wider-sprechen, über die Tausenden von Hinrichtungen, über den Genozid in La Vendée und all die anderen Katastrophen, die die Folgen der »Rebellion gegen die Rechtsprechung« waren – dann hätte man seine Aussagen als Warnung verstehen müssen und nicht als das, was sie wirklich waren, nämlich Zustimmung.
Doch nicht nur die Französische Revolution kann illustrieren, was geschieht, wenn die Rechtsprechung aufgehoben wird. Wenn beim Prozess gegen Angeklagte keine dritte Partei präsent ist, niemand da ist, der die Pflicht hat, die Beweise zu prüfen, der zwischen den Parteien vermitteln oder unparteiisch auf die Tatsachen schauen kann, dann wird aus »Gerechtigkeit« ein Kampf auf »Leben und Tod«, in dem eine Seite über sämtliche Waffen verfügt. So war es bei den Moskauer Schauprozessen wie auch bei den Revolutionstribunalen der Französischen Revolution. Dem Historiker Foucault muss das bekannt gewesen sein. Trotzdem verschrieb er sich bereitwillig der »proletarischen Justiz«, die den Angeklagten jeglicher Verteidigungsmöglichkeiten beraubt. Zu denken – und er scheint das wirklich gedacht zu haben –, dass diese Form der Gerichtsbarkeit die Gesellschaft von der Last der Herrschaft befreien würde, bedeutet all das zu übersehen, was er gewusst haben muss. Wenn die Gesellschaftsordnung tatsächlich aus der Substanz besteht, die Foucault »Macht« nannte, dann ist die Herrschaft des Rechts ihre beste und mildeste Form.