„Generation Angst“
Ist die Nutzung von Smartphones durch Kinder und Jugendliche ein Menschenexperiment, dessen Folgen wir noch gar nicht absehen können? Das Manifest „Generation Angst“ betrifft uns alle. Denn die Technologie destabilisiert Geist und Leben, sagt der amerikanische Psychologe Jonathan Haidt. Der Professor präsentiert dramatische Ergebnisse: „eine sprunghafte Zunahme von schweren Depressionen und Angststörungen bei jungen Amerikanern um rund 150 Prozent, also um das Zweieinhalbfache, ab dem Jahr 2010, eine Verdreifachung der Rate von Selbstverletzungen bei Mädchen sowie ein Ansteigen der Suizidrate um 188 Prozent.“
DIE WELT schreibt über das Buch Generation Angst [#ad] von Jonathan Haidt:
„Generation Angst“ ist eine Selbstkorrektur mit atemberaubender Pointe: Nicht Ideologien, so Haidt, seien dafür verantwortlich, dass die junge Generation sich in „Wokeismus“ verliere. Sondern die Verfasstheit der jungen Generation sei ihrerseits Symptom einer kollektiven Psychopathologie, die dadurch verursacht wurde, dass junge Menschen in einer besonders vulnerablen Entwicklungsphase mit Systemen sozialisiert wurden, die von ihrer Funktionsweise her allem widersprechen, was den Menschen als Art in den letzten Hunderttausenden von Jahren ausgemacht hat.
Haidt nennt einige Beispiele: Der Mensch sei von jeher ein Wesen, dessen soziale Interaktionen davon gekennzeichnet sind, dass sie „eins-zu-eins“ oder „eins-zu-mehreren“ funktionieren: Man spricht mit einem oder mehreren Menschen und erhält dabei über das, was Haidt „Synchronizität“, also „Gleichzeitigkeit“ nennt, permanent subtile Hinweise über „das richtige Timing“, über die „Wechselseitigkeit“ der Kommunikation. Social-Media-Plattformen hebeln diese urmenschliche Seinsweise aus: indem sie strukturell eine radikal erhöhte Anzahl von „Eins-zu-mehreren“-Kommunikationen ermöglichen (einer postet, Tausende lesen) und gleichzeitig völlig bereinigt von jedem natürlichen Feedback wie Mimik und Körpersprache sind, wirken sie auf uns destabilisierend.
Mehr (hinter einer Bezahlschranke): www.welt.de.
[#ad]
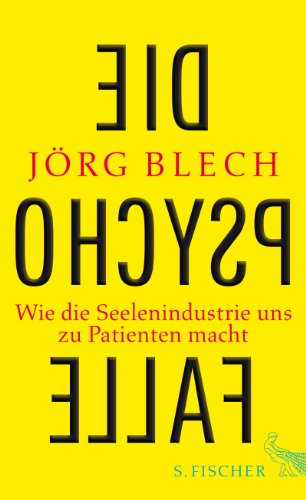 Diese Übersichtsanalyse offenbart, dass in den Industriestaaten des Westens die psychischen Störungen nach dem Zweiten Weltkrieg nicht zugenommen haben. Der vermutete Anstieg der psychiatrischen Krankheiten hat nicht stattgefunden. Die Münsteraner Epidemiologen stellen klar: „Die unterstellte Zunahme psychischer Störungen aufgrund des sozialen Wandels kann nicht bestätigt werden.“
Diese Übersichtsanalyse offenbart, dass in den Industriestaaten des Westens die psychischen Störungen nach dem Zweiten Weltkrieg nicht zugenommen haben. Der vermutete Anstieg der psychiatrischen Krankheiten hat nicht stattgefunden. Die Münsteraner Epidemiologen stellen klar: „Die unterstellte Zunahme psychischer Störungen aufgrund des sozialen Wandels kann nicht bestätigt werden.“