Slavoj Žižek und der christliche Atheismus
Der Philosoph und Psychoanalytiker Slavoj Žižek meint, Papst Franziskus könne man auch als Atheist verehren, denn er stünde für ein Verständnis von Liebe, dass auch für Menschen zugänglich sei, die nicht an Gott glauben. Er schreibt:
„In Anlehnung an die bahnbrechende Idee von Pater Raffaele Nogaro über die dringende Notwendigkeit, Christus selbst zu befreien, schlage ich vor, dass Christus als verschwindender Vermittler in jeder echten Liebe wirkt – er ist immer anwesend, wenn es Liebe zwischen Menschen gibt: „Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich unter ihnen“ (Matthäus 18,20). Christus ist also weder Subjekt noch Objekt der Liebe, er ist die Liebe selbst: „Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe“ (Johannes 4,8): „Jesus hat das erste Gebot des alten Gesetzes ‚Du sollst deinen Gott, den Meister, lieben‘ (Deuteronomium 6,5) durch ein Gebot ersetzt, das als unmittelbaren Empfänger der Liebe nicht Gott, sondern den Nächsten nennt.“ Nogaro zitierte in unserem Gespräch Dietrich Bonhoeffer, der zum Schluss in diese Richtung geht: „Ein Christ ist nicht ein religiöser Mensch, sondern einfach ein Mensch, ‚ein Wesen für andere‘, wie Jesus.“
Aber von welcher Art der Liebe sprechen wir hier? Im Dialog zwischen Jesus und Petrus in Johannes 21,9 werden zwei verschiedene Wörter für „Liebe“ verwendet: agapaô (die Verbform des Substantivs agape) und phileô (die Verbform des Substantivs philia). Der Dialog läuft folgendermaßen ab: Jesus fragte: „Agapâis du mich?“ Petrus antwortete: „Ich phileô dich.“ Jesus fragte: „Agapâis du mich?“ Petrus antwortete: „Ich phileô dich.“ Jesus fragte: „Phileis du mich?“ Petrus antwortete: „Ich phileô dich.“ Ich stimme mit denjenigen überein, die behaupten, dass diese Änderung des fraglichen Verbs auf die gnädige Herablassung Jesu auf jene Ebene hinweist, auf der Petrus an diesem Punkt bereit war, zu antworten. Philia ist die Liebe zu einem anderen Menschen, in Abwesenheit Christi als verschwindendem Vermittler.
Genau genommen gibt es in der Heiligen Schrift vier Begriffe für die Liebe: Eros (sexuelle Liebe), Storge (elterliche, familiäre Liebe), Philia (ungeschlechtliche Zuneigung/Freundschaft) und Agape (die bedingungslose Liebe, die Menschen vereint, die ihr Leben einer Sache widmen). Auf der Ebene der Agape spielen Gefühle (sexuell oder nicht) keine Rolle mehr, was bleibt, ist einfach der Heilige Geist, eine egalitäre Gemeinschaft von Kameraden, die sich einer Sache verschrieben haben.“
Ich habe gerade nicht die Zeit, um detailliert auf diese Aussagen einzugehen. Aber es fallen auf Anhieb vier Dinge auf, die ich zumindest erwähnen möchte:
Erstens wird deutlich, dass Slavoj Žižek als Psychoanalytiker irgendwie von Erich Fromm beeinflusst ist, einem Vertreter der Frankfurter Schule. Fromm hat sinngemäß das biblische „Gott ist die Liebe“ (1Joh 4,8) umgekehrt und humanistisch-transzendent gedeutet: Da wo Liebe ist, ist Gott. Der Glaube an einen Gott ist der Glaube an das höchste in uns selbst. (vgl. Die Kunst des Liebens u. Psychoanalyse und Religion).
Zweitens übernimmt Slavoj Žižek, so wie viele Prediger auch, die semantische Unterscheidung zwischen agapaô und phileô (vgl. Nygren). Demnach beziehe sich agapaô immer auf eine höhere oder göttliche Liebe und phileô auf eine sinnlichere oder horizontale Liebe. Das gilt als widerlegt. So schrieb beispielsweise D.A. Carson (Die komplexe Lehre von der Liebe Gottes, 2022, S. 29, [#ad]):
Selbst innerhalb des griechischen Alten Testaments ist es keineswegs eindeutig, dass sich die Wortgruppe agapaô immer auf eine „höhere“ oder edlere oder weniger emotionale Form der Liebe bezieht. Zum Beispiel vergewaltigt Amnon in 2.Sam 13 (LXX) seine Halbschwester Tamar inzestuös. Er „liebt“ sie, wird uns gesagt. Seine Tat ist ein bösartiger Akt, offensichtlich sexuell, emotional und gewalttätig – und sowohl agapaô als auch phileô werden verwendet.
Damit ist ist auch widerlegt, dass es im Spektrum von Agape keine Leidenschaft gibt.
Drittens kommt, anders als Žižek es oben behauptet, der Begriff érōs in der Bibel (streng genommen) nicht vor, auch wenn dort natürlich auch auf die leidenschaftliche und erotische Liebe bezug genommen wird. Zu finden ist érōs lediglich in der LXX (also der griechischen Übersetzung des hebräischen AT) in Spr 7,18 u. Spr 24,51.
Viertens empfehle ich im Blick auf die religionslose Interpretation des Christseins bei Bonnhoeffer die Untersuchung Widerstand und Versuchung: Als Bonhoeffers Theologie die Fassung verlor (2022, [#ad]). Frisch deutet den erstrebten und in Widerstand und Ergebung dokumentierten Versuch eines religionsfreien Glaubens bei Bonhoeffer als Anfechtung. Frisch im O-Ton: „Man kann nicht dem metaphysischen Gott den Laufpass geben und sich zugleich von guten Mächten wunderbar geborgen in diesem Gott wiederfinden“ (S. 59, siehe die Buchbesprechung hier: RalfFrisch_Bonhoeffer.pdf).
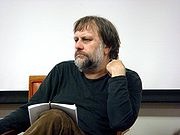 Slavoj Žižek ist einer jener Berufsintellektuellen, die vor allem unerwartet sein wollen, ein Hysteriker wider den Zeitgeist. In dem Film »Žižek!«, der über ihn zu sehen war, erklärt er an einer Stelle, dass er nie aufhören könne zu reden. Wenn, so führt er aus, die Kette der Wörter abreißen würde, könnte das Publikum merken, dass dahinter nur ein großes Nichts zum Vorschein komme.
Slavoj Žižek ist einer jener Berufsintellektuellen, die vor allem unerwartet sein wollen, ein Hysteriker wider den Zeitgeist. In dem Film »Žižek!«, der über ihn zu sehen war, erklärt er an einer Stelle, dass er nie aufhören könne zu reden. Wenn, so führt er aus, die Kette der Wörter abreißen würde, könnte das Publikum merken, dass dahinter nur ein großes Nichts zum Vorschein komme.