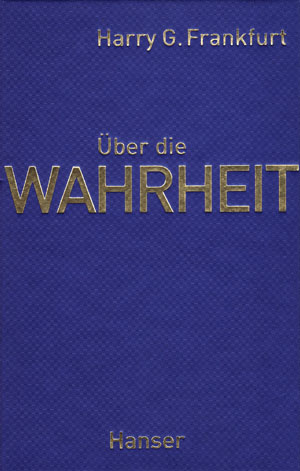Hören wir, wie zugespitzt bei Sören Kierkegaard die leidenschaftliche Innerlichkeit zum Wahrheitskriterium der Gottesfrage wird.
Wenn einer, der mitten im Christentum lebt, zu Gottes Haus hinaufsteigt, zu des wahren Gottes Haus, mit der wahren Vorstellung von Gott im Wissen, und dann betet, aber in Unwahrheit betet; und wenn einer in einem heidnischen Lande lebt, aber mit der ganzen Leidenschaft der Unendlichkeit betet, obgleich sein Auge auf einem Götzenbild ruht: wo ist dann am meisten Wahrheit? Der eine betet in Wahrheit zu Gott, obgleich er einen Götzen anbetet; der andere betet in Unwahrheit zu dem wahren Gott, und betet daher in Wahrheit einen Götzen an. (Unwissenschaftliche Nachschrift: 342)
Es würde mich nicht wundern, wenn dieses Gleichnis von der »Emerging Church-Bewegung« positiv aufgenommen wird.
Kurz: Die Emerging Church-Bewegung (EmCh) (engl. ›to emerge‹: ›auftauchen‹, ›sich bilden‹, ›sichtbar werden‹) ist eine post-evangelikale Reformbewegung innerhalb konservativer und westlich geprägter christlicher Kreise. Die Väter der Bewegung versuchen den christlichen Glauben gegenwartsnah zu gestalten und den postmodernen Strukturen und Codes anzupassen. (Was in gewisser Weise in der Tat hilfreich sein kann und von Teilen der Bewegung auf beeindruckend erfolgreiche Weise umgesetzt wird.)
Wichtigster Vordenker der Bewegung ist Brian McLaren, der früher zu einer Brüdergemeinde gehörte. McLaren dekonstruiert viele (und darunter wesentliche) Begriffe und Positionen der reformatorischen Lehre und definiert sie aus seinem postmodernen Verstehenshorizont heraus neu. Diese Reformulierungen seien nötig, da die reformatorische Lehre auf dem Hintergrund des modernen Weltbildes entwickelt worden sei. McLaren steht in der existentialistischen Tradition und äußerst sich skeptisch gegenüber einem inhaltlich bestimmbaren oder bestimmten Glauben. Obwohl er persönlich meint, dass es außerhalb des Erlösungswerkes von Jesus Christus kein Heil gibt, hält er an der Option fest, dass Gott auch außerhalb des Glaubens an Jesus Christus Heil vermittelt. Christen sollen (im Namen von Jesus Christus) Freunde anderer religiöser Gemeinschaften werden und sich für das Wachstum des Weizens in allen Religionen einsetzen (vgl. McLaren, A generous or+hodoxy: 287) McLaren schreibt:
Es mag unter vielen (nicht allen!) Umständen ratsam sein, Menschen zu helfen, Nachfolger Jesu zu werden und [Hervorhebung im Original] dabei in ihrem buddhistischen, hinduistischen oder jüdischen Kontext zu belassen. (A generous or+hodoxy: 293)
Ich finde diesen Gedanken dichotomisch. McLaren erweckt zunächst den Eindruck, es wäre unmöglich, Respekt vor anderen Religionen und Kulturen zu haben und zugleich missionarisch zu einem »Glaubenswechsel« einzuladen. (Genauso, wie er wohl in Frage stellt, dass man Respekt für Homosexuelle haben könne, wenn man eine weitere rechtliche Privilegierung Homosexueller, z.B. in der Familienpolitik, ablehne. Vgl. McLaren, A generous or+hodoxy: 20). Tatsächlich setzt sich z. B. gerade die Evangelische Allianz seit ihrer Gründung 1846 für den Schutz anderer Religionen und Minderheiten ein (Vgl. dazu Karl Heinz Voigt u. Thomas Schirrmacher (Hrsg.), Menschenrechte für Minderheiten in Deutschland und Europa, Bonn: VKW 2004). Außerdem sehe ich hier eine Dichotomie zwischen inneren Glaubensüberzeugungen und äußerlichen Glaubensbekundungen. In der Reformationszeit nannte man Menschen, die innerlich der Reformation zustimmten und dennoch an der Eucharistie teilnahmen, Nikodemiten. Sie waren die verborgenen Evangelischen, da sie Diskriminierung und Verfolgung fürchteten. (Der Begriff leitet sich von Nikodemus ab, der ein öffentliches Bekenntnis zu Jesus scheute. Vgl. Joh 3). Sollte McLaren von einem »anonymen Christsein« ausgehen (im Sinne Karl Rahners) oder gar keinen substantiellen Unterschied zwischen dem eigentlich »Guten«, »Heiligen« oder »Göttlichen« in den unterschiedlichen Religionen ausmachen, umgeht er zwar diese Aufspaltung, zahlt jedoch einen hohen Preis. Eine Prüfung der Geister scheint dann nicht mehr möglich zu sein.
Ein anderer Vordenker der Bewegung ist Dave Tomlinson, der im Jahre 1995 sein bemerkenswertes Buch The Post-Evangelical veröffentlichte. Ein Gleichnis aus diesem Buch erinnert stark an Kierkegaards oben zitierte Illustration des subjektiven Wahrheitsbegriffes.
Jesus erzählte auf einer Versammlung evangelikaler Verantwortlicher ein Gleichnis. Ein Spring-Harvest-Redner und ein liberaler Bischof setzten sich und lasen, jeder für sich, die Bibel. Der Spring-Harvest-Redner dankte Gott für das herrliche Geschenk der Heiligen Schrift und gelobte einmal mehr, sie vertrauensvoll öffentlich zu verkündigen. »Danke, Gott«, betete er, »daß ich nicht bin wie dieser arme Bischof, der dein Wort nicht glaubt, und der unfähig scheint, sich zu entscheiden, ob Christus nun von den Toten auferstanden ist oder nicht.« Der Bischof schaute verlegen, als er die Bibel durchblätterte, und sagte, »Jungfrauengeburt, Wasser zu Wein, leibliche Auferstehung. Ich weiß ehrlich nicht, ob ich diese Dinge glauben kann, Herr. Ich bin mir nicht einmal sicher, daß ich glaube, daß du ein personales Wesen bist, aber ich werde weiter auf der Suche bleiben.« Ich sage euch, dieser liberale Bischof ging vor Gott gerechtfertigt nach Hause, nicht jener. (Tomlinson, 2003: 61f, zitiert aus Knieling, Unsicher – und doch gewiß, 1999: 101–102)
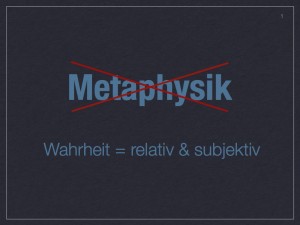 Die meisten Menschen haben ein ganz gutes Gespür dafür, was Wahrheit ist. Andererseits ist »Wahrheit« umstrittener als jeder andere Begriff. Ohne große Anstrengungen wäre es möglich, mehr als 10 Wahrheitstheorien aufzulisten, die in den Geisteswissenschaften oder der Wissenschaftstheorie miteinander konkurrieren. Hinzu kommt die Tatsache, dass die Wahrheit eine lange und nicht immer ruhmreiche Geschichte hat. Im Namen der Wahrheit wurden bedeutende Bücher verfasst und Menschen befreit. Doch im Namen der Wahrheit wurden ebenfalls furchtbarste Verbrechen verübt, Fehlurteile gefällt und tragische Kriege angezettelt. Der Wahrheitsbegriff ist also zwiespältig und komplex.
Die meisten Menschen haben ein ganz gutes Gespür dafür, was Wahrheit ist. Andererseits ist »Wahrheit« umstrittener als jeder andere Begriff. Ohne große Anstrengungen wäre es möglich, mehr als 10 Wahrheitstheorien aufzulisten, die in den Geisteswissenschaften oder der Wissenschaftstheorie miteinander konkurrieren. Hinzu kommt die Tatsache, dass die Wahrheit eine lange und nicht immer ruhmreiche Geschichte hat. Im Namen der Wahrheit wurden bedeutende Bücher verfasst und Menschen befreit. Doch im Namen der Wahrheit wurden ebenfalls furchtbarste Verbrechen verübt, Fehlurteile gefällt und tragische Kriege angezettelt. Der Wahrheitsbegriff ist also zwiespältig und komplex.