Empirischen Daten, Umfragen, Netzwerke und Statistiken treiben heute die Wissenschaft und Politik vor sich her. Das Rezept für erfolgreiches Forschen lautet: „Man nehme zentrale ‚qualitätstragende‘ Schlag- und Signalwörter in ausreichender Menge, verwende reichlich einschlägige Messwertangaben in Abbildungen und Tabellen und garniere das Ganze mit vielversprechenden Zitationen und internationalen Kooperationen“. Das meinen jedenfalls die Pädagogen Katja Koch und Stephan Ellinger, die derzeit für viel Aufruhr sorgen. Sie haben so etwas wie die deutsche „Sokal-Affäre“ angestoßen.
Die Sokal-Affaire
Der Physiker Alan Sokal sorgte 1996 für einen Skandal, indem er in einer angesehenen Fachzeitschrift eine Parodie auf das postmoderne Denken publizierte. In seinem anspruchsvollen Aufsatz „Die Grenzen überschreiten: Auf dem Weg zu einer transformativen Hermeneutik der Quantengravitation“ übertrug er typisch postmoderne Denkweisen auf die Naturwissenschaften. Auf diese Weise erweckte er den Eindruck, dass auch in den harten Wissenschaften nicht Tatsachen und Beweise, sondern subjektive Interessen und Perspektiven zählen. Der Beitrag, der vom intellektuellen Establishment dankbar aufgenommen wurde, war freilich eine Aneinanderreihung von barem Unsinn (siehe meine Schilderung hier).
„Kuno bleibt am Ball (KUBA)“
Einen ähnlichen „Fake“ produzierten Koch und Ellinger kürzlich in der Zeitschrift für Heilpädagogik (11/2016). Dort stellten sie die Behauptung auf, durch ein evidenzbasiertes Förderprogramm mit dem Titel „Kuno bleibt am Ball (KUBA)“ könnten die individuellen Folgen sozialer Übervorteilung bei Kindern nachhaltig abgeschwächt werden.
Nicht nur den Namen des Programms haben sie frei erfunden. Ähnlich wie bei Sokal ist der gesamte Aufsatz eine Zusammenfügung unsinniger Floskeln. Durch Signalwörter, Messwertangaben und Querverweise wurde der Unfug clever getarnt. Die Autoren wollten so den Nachweis erbringen, dass in der pädagogischen Fachwelt die absurdesten Thesen durchgehen, wenn der Sprachduktus passt.
Die Sonderpädagogen erklärten ihr Experiment später mit den Worten:
„Nun ist nicht weiter verwunderlich, wenn niemand bemerkt, dass statistische Kennwerte frei erfunden und Effektstärken nur ausgedacht sind. Solange die Zahlen plausibel sind, kann man das auch gar nicht bemerken. Offenkundig aber ist, und genau darum ging es uns, dass der vorgelegten Empirie eine schlüssige theoretische Grundannahme fehlt. Wir wollen auf die Tendenz hinweisen, dass immer häufiger nicht mehr die Plausibilität einer Theorie oder Logik eines Arguments, sondern einzig die Überzeugungskraft der dargestellten Daten, Zahlen und Forschungsmethoden über die Diskussionswürdigkeit eines Beitrages entscheidet. Wir sehen Anlass zur Sorge, dass durch die Dominanz ‚evidenzbasierter‘ Ausrichtung innerhalb der Sonderpädagogik ernsthafte pädagogische Überlegungen zu drängenden Fragestellungen und offene Diskussionen bald gänzlich verdrängt werden.“
Kurz: Mit Berechnungen lässt sich viel illustrieren, erklären und begründen. Die Frage ist: Stimmen die Grundannahmen, auf denen die Kalküle beruhen?
Ein SPD-Politiker verteidigt das Experiment
Der Aufsatz brachte Heiterkeit und große Empörung. Sogar die Schlichtungsstellen der Universitäten Rostock und Würzburg sind angerufen worden.
Der SPD-Politiker Mathias Brodkorb hat erfreulicherweise in der FAZ Stephan Ellinger und Katja Koch jetzt ehrwürdig verteidigt. Spitz bemerkt der Finanzminister Mecklenburg-Vorpommerns: „Während noch vor zwanzig Jahren in den Geisteswissenschaften das postmoderne Kauderwelsch hoch im Kurs stand, sind es im Zeitalter der empirischen Bildungsforschung Zahlen, Tabellen und stochastisches Vokabular“ (FAZ vom 01.12.2017, Nr. 27, S. N4).
Drei Thesen
Brodkorb geht noch weiter und stellt drei Thesen auf, die es in sich haben:
- Es gibt für die Wissenschaft nichts Wichtigeres als Wahrheit und Aufrichtigkeit: „Wenn es einen systematischen Unterschied zwischen tatsächlichem Wissen und bloßem Meinen gibt und dieser genau darin besteht, dass wirkliches Wissen aus wahren Sätzen besteht, für deren Richtigkeit sich Gründe angeben lassen (logon didonai), gibt es für jeden Wissenschaftler keinen helleren Stern als die Wahrheit und keine wichtiger Disposition als die Aufrichtigkeit.“
- Leider ist auch die sonderpädagogische Community durch Machtspiele gezeichnet [man denke an Lyotards: „Forscher kauft man sich“]: „In der pädagogischen Wissenschaft haben seit Pisa jene Fachvertreter eine hegemoniale Stellung inne, die besonders gut rechnen können oder zumindest so viele Forschungsgelder eintreiben, dass sie wissenschaftliche Mitarbeiter bezahlen können.“ Die Vertreter der evidenzbasierten Sonderpädagogik wollen „nicht wahrhaben und vor allem nicht dulden, dass ihre hegemoniale Stellung in Frage gestellt wird“.
- Die Wissenschaftswelt braucht dringend mehr Bereitschaft für Selbstkritik: „Wenn die Wissenschaft die unbedingte Wahrheitssuche für sich reklamiert, kann sie damit vor ihren eigenen Toren nicht halt machen. Eine wissenschaftliche Disziplin, die zwar beansprucht, die Welt da draußen nach Herzenslust zu beurteilen und zu kritisieren, aber nicht bereit ist, eben diese Kritik für sich selbst gelten zu lassen, wird zur bloßen Ideologie.“
So kann es weiter gehen!
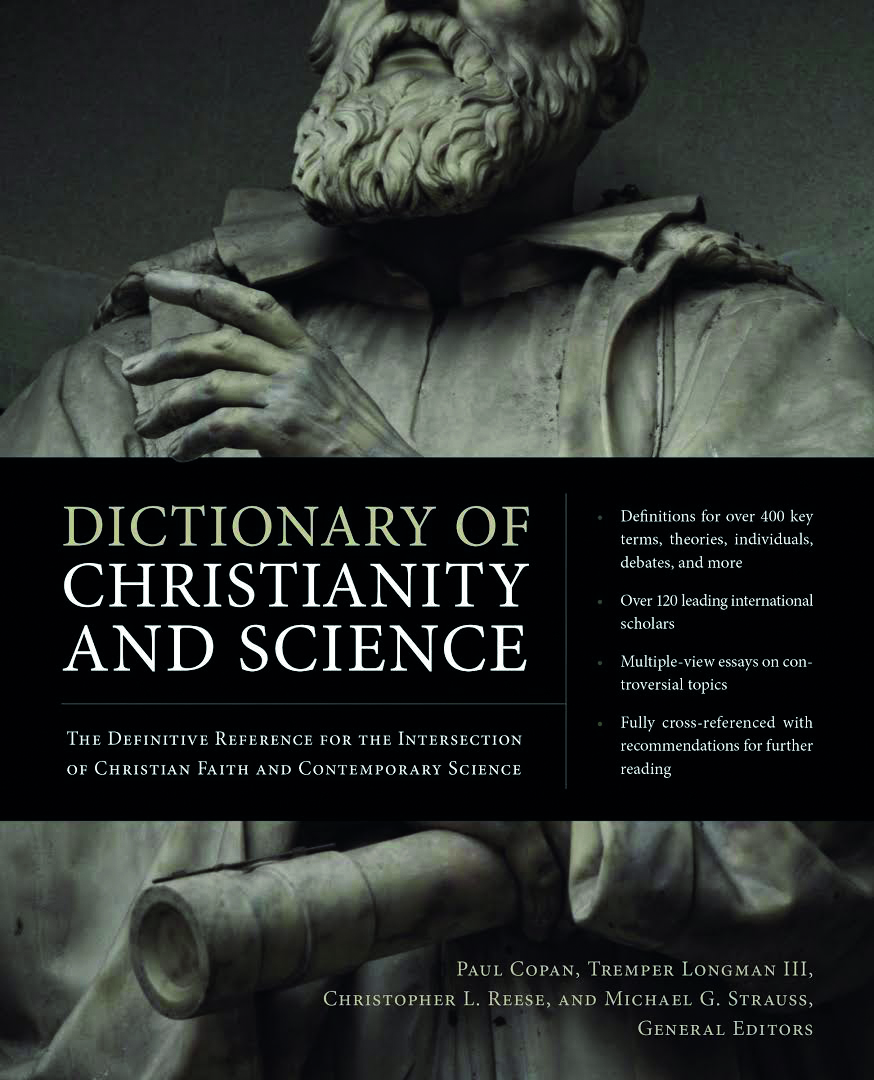 Das Lexikon für Christentum und Wissenschaft enthält mehr als 450 Einträge zu Schlüsselbegriffen, Theorien, Persönlichkeiten, Bewegungen und Debatten rund um Themen über den christlichen Glauben und die Wissenschaft. Geschrieben wurden die Artikel von über 150 internationalen Fachleuten, darunter Winfried Corduan, William Lane Craig, William A. Dembski, Douglas Groothius, Angus Menuge oder Peter S. Williams.
Das Lexikon für Christentum und Wissenschaft enthält mehr als 450 Einträge zu Schlüsselbegriffen, Theorien, Persönlichkeiten, Bewegungen und Debatten rund um Themen über den christlichen Glauben und die Wissenschaft. Geschrieben wurden die Artikel von über 150 internationalen Fachleuten, darunter Winfried Corduan, William Lane Craig, William A. Dembski, Douglas Groothius, Angus Menuge oder Peter S. Williams.