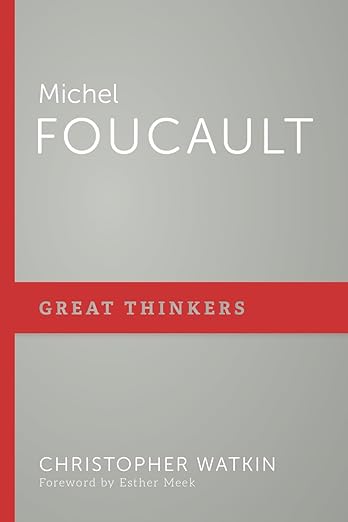Postkolonialismus an Universitäten
Eine angesehene Londoner Hochschule will die Philosophie „dekolonisieren“. Die Deutsche Gesellschaft für Philosophie springt auf den Zug auf und möchte den Kanon von weißen, männlichen Denkern säubern.
Was sich als bloße Empfehlung tarnt, dürfte bald zur Waffe gegen Andersdenkende werden. Hier ein CICERO-Beitrag von Wissenschaftsphilosophen zu dieser Entwicklung:
So was kommt von so was: An der Londoner School of Oriental and African Studies (SOAS, London), das zum Hochschulverbund der University of London gehört, wurde vor einigen Tagen ein „Decolonising Philosophy Toolkit“ (DPT) veröffentlicht. Es ist eine Anleitung zu dem Projekt, philosophisches Forschen und Lehren und insbesondere auch philosophische Curricula zu „dekolonisieren“, also von den behaupteten Vorurteilen und kolonialistisch-rassistischen Strukturen westlich-weißer Philosophie zu befreien.
In dieser Anleitung wird exemplarisch einem „Traditional-cum-Colonial“-Modul zur Erkenntnistheorie ein dekolonisiertes Modul gegenübergestellt. Während der klassische Semesterplan ganz herkömmlich etwa Platon, Russell, Hume, Descartes und neuere analytische Personen und Positionen enthält (z.B. Internalismus vs. Externalismus), sind im dekolonisierten Semesterplan diese, wie es heißt, „westlichen“, „weißen“, „bourgeoisen“, „heteronormativen“ und „eurozentrischen“ Personen und Positionen fast komplett getilgt; stattdessen geht es fast ausschließlich um Philosophie afrikanischer, asiatischer oder auch indigener Herkunft und spezifisch etwa um „Decolonising the Mind“, „Constructing the Epistemologies of the Global South“, um „Conceptualising Epistemic Oppression“, um „On Being White“ oder auch um „Children of the Palms: Growing Plants and Growing People in a Papuan Plantationocene“. Fast könnte man bei der Lektüre meinen, es wäre eine Satire.
Zwar heißt es in dem Toolkit, es gehe um ein dialogisches Model, in dem keine Kultur eine privilegierte Position habe; aber die reale Ausführung beweist die tatsächliche Absicht. Sie wollen nicht die Macht teilen, wie sie sagen, sie wollen sie haben. Umso grotesker ist, dass der Toolkit die Annahme, Postkolonialisten wollen doch nur Platon & Co. aus den Curricula verbannen, als Zerrbild darstellen; denn der vorgeschlagene dekolonisierte Semesterplan straft sie Lügen. Selbst wenn man nun einräumen würde, dass Philosophien dieser Herkunft und dieses Typs die Bezeichnung als „Philosophie“ wirklich verdienen und methodischen Ansprüchen wirklich genügen, kann die Vorgehensweise offenkundig nicht darin bestehen, die westliche Philosophie (von den Vorsokratikern bis zur Gegenwart) einfach komplett zu tilgen.
Mehr: www.cicero.de.