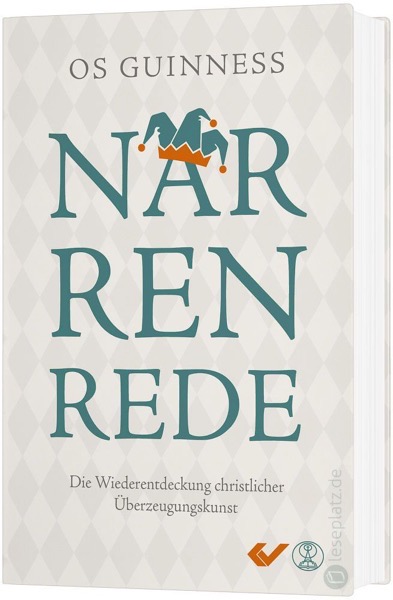Die Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (abgekürzt EZW) ist eine direkte historische Nachfolgeorganisation der Apologetischen Centrale (AC), die 1921 gegründet und 1937 unter Gestapo-Druck geschlossen wurde. Die AC wurde von dem Theologen Walter Künneth geleitet. Noch 1995 hat die EZW in ihrem Materialdienst auf diesen Entstehungszusammenhang hingewiesen. Ich zitiere (MATERIALDIENST DER EZW 5/1995, S. 156):
Walter Künneth war eine Schlüsselfigur, weil er ab 1932 die Apologetische Centrale leitete und ihr Profil prägte. Diese Centrale ist der unmittelbare Vorläufer der EZW, die ab 1960 ihre Arbeit fortsetzt – auch dank personeller und inhaltlicher Kontinuität. Die EZW versteht sich damit als Erbin der apologetischen, dokumentierenden und beratenden Arbeit, die Künneth in der AC geprägt hat.
Während einer Tagung der Evangelischen Notgemeinschaft in Deutschland e.V., die vom 31.3. bis 3.4. 1995 in Berlin-Spandau stattfand, wurde die im Aufbau befindliche Arbeit des im letzten Jahr gegründeten Walter-Künneth-Institutes vorgestellt. Das Institut hat die Aufgabe, „Strömungen des Zeitgeistes zu erkennen, seine verborgenen Tendenzen aufzuspüren, anhand biblisch-reformatorischen Schriftzeugnisses zu analysieren, kritisch zu beurteilen und die Ergebnisse für die Arbeit in Kirche und Gesellschaft umzusetzen“. Der erste Vorsitzende des Instituts, Adolf Künneth, verdeutlichte in einem Vortrag Aufgabenstellung und Arbeitsform des Instituts, das personell und institutionell eng der Evangelischen Notgemeinschaft zugeordnet ist und als Instrument zur Intensivierung der Arbeit verstanden werden kann. Künneth, pensionierter Jurist und Sohn des ehemaligen Leiters der Apologetischen Centrale in Berlin (von 1932 bis 1937) und späteren Erlanger Professors für Systematische Theologie, Walter Künneth, nannte in seinem Vortrag (Thema: „Von der , Apologetischen Zentrale‘ zum , Walter-Künneth-Institut‘. Wandel und Kontinuität christlicher Apologetik“) drei zentrale geistige Mächte, von denen sich die apologetische Arbeit heute insbesondere herausfordern lassen müsse und mit denen sich das Institut kritisch auseinandersetzen wolle: 1. Pluralismus bzw. Synkretismus, 2. Feminismus und 3. Sozialismus, der heute oft als Antifaschismus getarnt auftrete. Der Tagungsort, das Johannesstift in Berlin-Spandau, hatte auch symbolische Bedeutung. Bis Ende 1937 befand sich auf diesem Gelände die Apologetische Centrale, deren Arbeit das Walter-Künneth-Institut auf der inhaltlichen Ebene beerben möchte.
Wie sehr sich das Profil der EZW gewandelt hat, geht aus einem aktuellen Beitrag von Katharina Portmann hervor. Während früher die EZW den Feminismus noch als Problem eingestuft hat, ist es heute genau umgekehrt. Wer nicht für den Feminismus kämpft, hat ein Problem. Ich zitiere:
Nach biblizistischer Lesart sind biblische Aussagen direkt verständlich und zeitlos gültig. Am antifeministischen Motiv der Geschlechterkomplementarität, das der biblischen Schöpfungserzählung entnommen wird, lässt sich aufweisen, dass dieses hermeneutische Axiom einer Selbsttäuschung unterliegt. Denn die fragliche biblische Begründung ist blind für den massiven Einfluss der kulturellen Entwicklungen des 19. und 20. Jahrhunderts, die unser heutiges Verständnis von Mann- und Frausein maßgeblich prägen. Im Zuge der industriellen Revolution und des damit wachsenden Wohlstands der Bevölkerung haben sich Arbeitswelt und häusliche Sphäre scharf getrennt und wurden unter den Geschlechtern aufgeteilt. Den Frauen wurden aufgrund ihres Geschlechts und insbesondere aufgrund ihrer Fähigkeit, Kinder zu gebären, spezifische Eigenschaften zugeschrieben, die ihren Aktionsradius auf den häuslichen bzw. privaten Bereich beschränkten, während Männer der Erwerbsarbeit nachgingen und den öffentlichen Raum bestimmten (vgl. Schößler und Wille 2022, 15).
Die Überzeugung, Männer und Frauen seien gleichwertig, aber nicht gleichartig geschaffen, ist folglich kein Resultat der Bibelauslegung, sondern eine Projektion kultureller Selbstverständlichkeiten des 19. und 20. Jahrhunderts in die biblischen Texte. Es tritt klar zutage, dass die Bibel eben nicht losgelöst von kulturellen Vorverständnissen interpretiert werden kann. Die betreffende Geschlechterethik orientiert sich also nicht allein an der biblischen Überlieferung, sondern sucht das zu Beginn des 21. Jahrhunderts ins Wanken geratene Weltbild der beiden vorherigen Jahrhunderte zu zementieren.
Ein weiteres Kernproblem des Biblizismus ist die Ausblendung innerbiblischer Ambivalenzen oder Widersprüchlichkeiten. Auch hiervon ist die Überzeugung von der wertgleichen, aber nicht wesensgleichen Beschaffenheit von Männern und Frauen betroffen. Sie harmonisiert die Fülle von biblischen Beispielen für ein konfliktreiches und ambivalentes Geschlechterverhältnis. Und sie ignoriert dabei die vorhandenen diskriminierenden und sexistischen Passagen der Bibel – man denke nur an das zehnte Gebot, das Frauen als Besitz des Mannes definiert. Die Bibel stammt aus einer Zeit, die von patriarchalen Familien- und Gesellschaftsstrukturen geprägt war – diese Strukturen konsequent zur Norm für unsere Zeit zu erheben, würden sich auch die konservativsten Christen, jedenfalls die Frauen unter ihnen, kaum gefallen lassen.
Schade. Die EZW hat früher gute Materialien geliefert. Inzwischen betreibt die Zentralstelle jedoch vor allem die Apologie des Zeitgeistes. Ich vermute, dass die Experten gar nicht mehr wissen, was ein biblisch-reformatorisches Schriftverständnis ist.
Mehr: www.ezw-berlin.de.