Mitten in der Kapitalismuskrise wird von der linken Avantgarde der Kommunismus neu entdeckt. Ihr Star ist der slowenische Philosoph Slavoj Žižek, der Marxismus mit Pop und Psychoanalyse vermischt (siehe auch hier).
Philipp Oehmke hat über Žižek, der derzeit so viele Bücher veröffentlicht, dass er selbst nicht dazu kommt, sie alle zu lesen, ein derart erheiternden Beitrag geschrieben, dass ich sogar bei 35 Grad Celsius mehrmals einem Lachkrampf erlegen bin. Wenn schon das Lesen eines Essay über Slavoj Žižek ein Erlebnis ist, kann man sich leicht vorstellen, was für ein Erlebnis es sein muss, ihn leibhaftig zu treffen.
Hier zwei Kostproben:
Am frühen Nachmittag endlich sitzt Žižek in der ersten Reihe im großen Saal der Volksbühne, er muss jetzt eine Stunde lang schweigen. Er kann vieles, aber das ist eine fast unlösbare Aufgabe. Neben sich hat er eine Plastiktüte von Saturn, in der er alles transportiert, was er braucht in diesen drei Tagen. Der Saal ist voll, die rund tausend Zuhörer sitzen sogar auf den Treppenstufen. Es sind junge Menschen, die meisten unter dreißig, ein Panoptikum linker Subkulturen, manche haben sich als Brecht verkleidet, andere als Sartre, viele sehen aus, als wären sie auf Rucksacktrip durch Südostasien und würden gleich anfangen, mit brennenden Keulen zu jonglieren. Alle haben Simultanübersetzungskopfhörer auf den Ohren, denn die Vorträge sind auf Französisch (Badiou), Italienisch (Negri) oder Englisch mit starkem Akzent (Žižek und der Rest). Nur Žižek hat keinen Kopfhörer auf den Ohren, er braucht keinen, er ist fließend in sechs Sprachen, darunter auch Deutsch.
Dabei sind die meisten Wortbeiträge schon in ihrer Originalsprache kaum zu verstehen. Simultan übersetzt werden sie zu sinnfreier Lyrik. Aber es soll hier nicht um einfache, um konkrete Antworten gehen, die gibt es bei der Linkspartei oder den Gewerkschaften. Genauso wenig soll es um einen Blick zurück in die Geschichte gehen, zurück in das düstere 20. Jahrhundert, zu seinen Katastrophen, die im Namen des Kommunismus geschehen sind, zu seinen Opfern, zu den mehr als 30 Millionen Ermordeten, zu Stalin, zu Pol Pot, den Arbeitslagern, der Überwachung. Nein, es soll hier um Theorie gehen, um eine neue „kommunistische Hypothese“, wie Badiou es nennt, um Universalismus, das Subjekt in der Geschichte, Wahrheitsereignisse, um Hegel und um Psychoanalyse nach Jacques Lacan.
Žižek hat eine Kunstfigur erschaffen, seine Auftritte sind Performances, irgendetwas zwischen Kunst und Comedy. Er sagt, er möchte weg von diesen Stand-up-Comedy-Auftritten, in Berlin will er einen ernsthaften Vortrag halten, vor allem über Georg Wilhelm Friedrich Hegel, von ihm handle auch sein neues Buch, 700 Seiten habe er schon geschrieben. Für 700 Seiten über den vielleicht schwierigsten Denker der Philosophiegeschichte braucht ein normaler Mensch zehn Jahre. Žižek hat es in den vergangenen Monaten im Flugzeug geschrieben.
Nach exakt drei Stunden Žižek-Time passiert Tröstliches. Plötzlich scheint sein Akku leer, die Maschine stoppt. Žižek hat Diabetes, der Blutzucker ist viel zu hoch, nein, viel zu niedrig, die Krankheit scheint im Moment besonders schlimm zu sein. Doch Slavoj Žižek wäre nicht Slavoj Žižek, wenn er das so banal sagen würde. Er sagt lieber: »Wissen Sie, meine Diabetes ist inzwischen ein sich selbst erhaltendes System: völlig unabhängig von äußeren Einflüssen! Sie macht, was sie will. Und jetzt muss ich schlafen.«
Den vollständigen Text gibt es hier: www.spiegel.de.
 Und wieder eine neue Perspektive:
Und wieder eine neue Perspektive: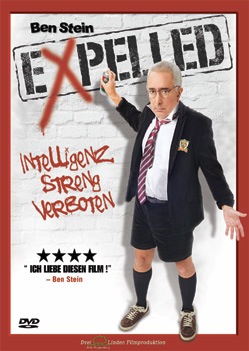 Obwohl ich bereits mehrmals
Obwohl ich bereits mehrmals 
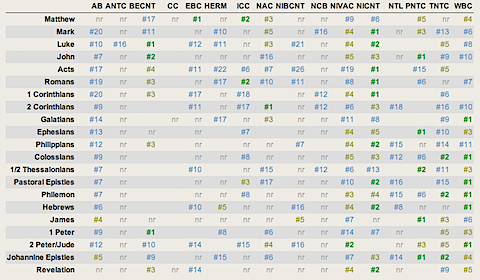
 Für alle, die sich durch diesen Blog und andere religiös ausgerichtete Internetseiten belästigt fühlen, gibt es Hoffnung. Einige um unsere Volksgesundheit besorgte Kinder- und Lebensschützer entwickeln gerade den Filter
Für alle, die sich durch diesen Blog und andere religiös ausgerichtete Internetseiten belästigt fühlen, gibt es Hoffnung. Einige um unsere Volksgesundheit besorgte Kinder- und Lebensschützer entwickeln gerade den Filter 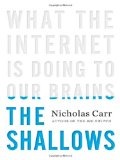 Durch das Internet akzeptieren wir bereitwillig den Verlust von Konzentration und des Fokus bei unseren Denkprozessen, behauptet Nicholas Carr in seinem letzten Buch
Durch das Internet akzeptieren wir bereitwillig den Verlust von Konzentration und des Fokus bei unseren Denkprozessen, behauptet Nicholas Carr in seinem letzten Buch  Der Künstler
Der Künstler