 Der Philosoph Prof. Dr. Dr. Daniel von Wachter hat an der Universität München eine Habilitationsschrift über Die kausale Struktur der Welt: eine philosophische Untersuchung über Verursachung, Naturgesetze, freie Handlungen, Möglichkeit und Gottes Wirken in der Welt geschrieben. Er ist ein der anglikanischen Kirche zugehöriger Christ und lehrt an der Internationalen Akademie für Philosophie in Santiago de Chile. Das Buch wurde mit dem Karl-Alber-Preis ausgezeichnet und ist beim Verlag Alber erschienen. Eine frühere Fassung ist frei herunterladbar. Es gibt zudem ein Forum zur Diskussion über das Buch.
Der Philosoph Prof. Dr. Dr. Daniel von Wachter hat an der Universität München eine Habilitationsschrift über Die kausale Struktur der Welt: eine philosophische Untersuchung über Verursachung, Naturgesetze, freie Handlungen, Möglichkeit und Gottes Wirken in der Welt geschrieben. Er ist ein der anglikanischen Kirche zugehöriger Christ und lehrt an der Internationalen Akademie für Philosophie in Santiago de Chile. Das Buch wurde mit dem Karl-Alber-Preis ausgezeichnet und ist beim Verlag Alber erschienen. Eine frühere Fassung ist frei herunterladbar. Es gibt zudem ein Forum zur Diskussion über das Buch.
TheoBlog.de hat mit dem Philosophen über seine Untersuchung gesprochen:
Die Vernunft wehrt sich nicht gegen Wunder
Interview mit dem Philosophen Daniel von Wachter
Theoblog: Herr von Wachter, welche Philosophen oder welche Epoche untersuchen Sie in diesem Buch?
W: Gar keine. Die Philosophie untersucht genauso wenig Philosophen oder Epochen wie die Physik Physiker oder die Biologie Biologen untersucht. Die Vorstellung, daß der Gegenstand der Philosophie Philosophen und deren Texte seien, hat zwei Quellen: Erstens haben die Positivisten, die behaupteten, daß nur die Naturwissenschaften Erkenntnis schaffen, gemeint, daß die einzige sinnvolle Aufgabe für Philosophen die Untersuchung alter Texte sei. Zweitens gibt es eine gewisse Angst davor, philosophische Fragen zu beantworten. Manchen fehlt einfach die Fähigkeit oder der Mut dazu, vielleicht weil sie ein großes Gewißheitsbedürfnis haben und diese Gewißheit in der Philosophie nicht finden. Es gibt noch eine dritte Quelle, eine hegelianische, aber die ist schwer zu beschreiben. In Deutschland haben sich nach dem Zweiten Weltkrieg die meisten Philosophen darauf beschränkt, Philosophiegeschichtsschreibung zu betreiben, vielleicht weil sie sich möglichst wenig weit aus dem Fenster lehnen wollten. Aber mein Eindruck ist, daß es jetzt mit der Philosophie in Deutschland wieder aufwärts geht.
Theoblog: Was untersucht dann Ihr Buch? Ist das für den Laien von Bedeutung?
W: Die kausale Struktur der Welt ist eines der großen alten Themen der Philosophie. In der angelsächsischen Philosophie gibt es heute eine ausgiebige, sehr komplizierte und abgehobene Diskussion über Verursachung. Aber das Thema ist von großer Bedeutung für eines jeden Menschen Weltbild, und viele haben den Mechanizismus verinnerlicht, das ist die Vorstellung, daß die Welt wie eine Maschine ist: sie besteht von vorn bis hinten aus kausalen Vorgängen. Alles, was geschieht, ist das Ergebnis eines Vorganges. Dadurch entsteht dann das Gefühl, daß Wunder oder Willensfreiheit unmöglich seien oder der Vernunft widersprächen oder von der Naturwissenschaft ausgeschlossen würden. Ich empfehle einen Selbsttest: Stellen Sie sich die Frage: „Gibt es Wunder, wie z.B. die Wiederlebendigwerdung und Auferstehung des gekreuzigten Leibes Jesu?“ und die Frage: „Können wir durch unser freies Handeln Kausalvorgänge in Gang setzen?“. Wenn Sie in sich Warnlampen leuchten oder eine Abneigung spüren, dann haben Sie sich von der mechanistischen Propaganda beeinflussen lassen.
Theoblog: Aber man kann doch Wunder nicht mit der Vernunft begreifen. Die Vernunft wehrt sich gegen Wunder.
W: Warum? Da wir hier auf einem Theologen-Blog sind, will ich anmerken, daß besonders Theologen das seit ca. 1800 ständig wiederholt haben, und es wird den Studenten auch heute noch eingeredet. Da wird vom „kausalen Nexus“, vom „wissenschaftlichen Weltbild“, von „historischer Methode“ geredet oder es wird einfach emphatisch gesagt, die Vernunft schließe Eingriffe Gottes in das Naturgeschehen aus. Aber nur Gründe, die man versteht, sind vernünftig – und es gibt hier weit und breit keine Gründe. David Hume hat versucht, aus unserer Kenntnis der Naturgesetze abzuleiten, daß es keine Wunder gebe. Obwohl Humes Argument von Anfang an schlagend kritisiert wurde, wurde es immer wieder hochgejubelt. Vor einigen Jahren schrieb der Philosoph John Earman ein Buch dazu mit dem treffenden Titel Hume‘s Abject Failure, was soviel heißt wie Humes jämmerliches Scheitern. Wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es natürlich keine Wunder. Aber wenn es Gott gibt, wofür es Beweise gibt, dann ist zu erwarten, daß er manchmal Wunder wirkt. Wieso soll denn das gegen die Vernunft sein? Vernünftigsein heißt richtig denken. Als die Jünger den auferstandenen Jesus gesehen haben, haben sie verstanden, daß Gott ihn auferweckt hat und daß er Gottes Sohn und der Messias ist. Was ist denn daran unvernünftig? Sie haben genau richtig gedacht, als sie das geschlossen haben.
Theoblog: Die Auferstehung übersteigt die Vernunft, denn die Vernunft sagt, daß Tote nicht auferstehen.
W: Nur, wenn Sie „Vernunft“ so definieren. Genau das hat die sog. „Aufklärung“ getan. Diese Autoren haben ständig wiederholt, daß Glaube an Gott, Wunder und die christliche Lehre Aberglaube sei und daß die Vernunft den Determinismus lehre, also die Lehre, daß jedes Ereignis durch einen kausalen Vorgang determiniert sei. Die Aufklärung hat diese Auffassung durch häufige nachdrückliche Wiederholung und nicht durch Argumente verbreitet. Das ist natürlich nicht vernünftig, sondern Propaganda. In Wirklichkeit ist es manchmal ganz vernünftig, etwas für ein Wunder zu halten, und es ist unvernünftig, die Möglichkeit von Wundern auszuschließen. Übrigens hat die Aufklärung die Verbreitung ihres Weltbildes auch dadurch gefördert, daß sie in der Philosophiegeschichtsschreibung andersdenkende Philosophen ignoriert und als aussterbende Spezies dargestellt hat und die ihr Weltbild teilenden Philosophen als die größten und einzig ernstzunehmenden Philosophen dargestellt hat. So entstand der heute übliche Kanon der angeblich größten Philosophen: Descartes, Hobbes, Spinoza, Hume, Kant, Hegel, usw.
Theoblog: Ist das eine der Kernthesen Ihres Buches?
W: Nur ein Nebenprodukt. Das Buch will vor allem untersuchen, was Verursachung, Naturgesetze und freie Handlungen sind. Um das gründlicher tun zu können, untersuche ich davor, was Möglichkeit ist, denn welche Theorie der Möglichkeit man annimmt, stellt die Weichen für die Beantwortung vieler anderer Fragen. Doch man muß das Buch nicht von vorne bis hinten lesen; auch wenn man nur einzelne Kapitel des Buches liest, sollte man das Wichtigste verstehen können. Mithilfe der Ergebnisse der genannten Untersuchungen analysiert das Buch dann, auf welche Weisen Gott in der Welt wirken könnte, z.B. indem er ein Universum erschafft, es erhält und manchmal in den Gang der Dinge eingreift. Ob es einen Gott gibt, untersucht dieses Buch nicht, das wäre ein anderes Thema.
Theoblog: Laut der elften Ihrer Zwanzig Thesen zur kausalen Struktur der Welt können Handelnde Vorgänge in Gang setzen. Hat die Hirnforschung nicht herausgefunden, daß unsere Handlungen das Ergebnis von Hirnvorgängen sind?
W: Sie spielen auf das Experiment von Benjamin Libet von 1982 an. Es ist zum Staunen, wie manchmal schlecht begründete Thesen viele überzeugen. Libet selbst hat sein Experiment so dargestellt als ob er den Versuchspersonen gesagt hätte, sie sollen ihre Hand bewegen, wann immer sie wollten. In Wirklichkeit hat er ihnen gesagt, sie sollen warten, bis ein Drang zum Bewegen der Hand aufkommt. Daß ein Drang eine vorangehende Ursache hat, ist mit der Annahme von Willensfreiheit zu vereinbaren. Diese und viele Einwände mehr gegen Libet mache ich gegen Libet in dem Buch und auch in zwei neueren Aufsätzen.
Theoblog: Was ist denn nun am Mechanizismus falsch?
W: Wegen der Quantenmechanik geben die meisten Autoren heute zu, daß es indeterministische, probabilistische Vorgänge geben kann. Aber weitgehend unangefochten ist die Annahme, daß jedes Ereignis das Ergebnis eines Vorgangs sei. Dem halte ich zweierlei entgegen: Erstens ist jeder Vorgang aufhaltbar. Seit Hobbes hat sich die Vorstellung verbreitet, das alle Ereignisse von vorangegangenen Ereignissen erzwungen werden. Aber das ist nicht nur nicht der Fall, sondern unmöglich. Jeder Vorgang kann gestoppt oder abgelenkt werden, wenn es nur etwas gibt, was stark genug ist, ihn zu stoppen, und dieses auch tut. Zweitens können Lebewesen Vorgänge in Gang setzen. Die Mechanisten wollen uns einreden, daß es offensichtlich sei, daß jedes Ereignis das Ergebnis eines Vorgang sei. Doch haben Sie den Eindruck, daß alles um Sie her, wie ein Uhrwerk oder wie das Rollen der Kugeln auf einem Billardtisch abläuft? Wenn ich den Kolibri vor meinem Fenster oder die auf den Baum springende Katze ansehe, habe einen anderen Eindruck. Mein Buch will im Detail untersuchen, daß dieser Eindruck richtig ist.
Theoblog: Danke für das Gespräch!
– – –
Das Interview kann hier in Form einer PDF-Datei heruntergeladen werden: Wachter.pdf.

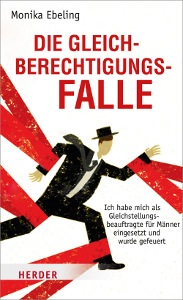 Im Mai 2011 wurde Monika Ebeling aus ihrem Amt der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Goslar abberufen, weil sie sich in ihrer Gleichstellungsarbeit auch für Männer engagiert hatte. Im Buch Die Gleichberechtigungsfalle erzählt Monika Ebeling nicht nur die Geschichte ihrer Abberufung. Bruno Köhler hat seine Rezension des Buches freundlicherweise online gestellt. Er schreibt:
Im Mai 2011 wurde Monika Ebeling aus ihrem Amt der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Goslar abberufen, weil sie sich in ihrer Gleichstellungsarbeit auch für Männer engagiert hatte. Im Buch Die Gleichberechtigungsfalle erzählt Monika Ebeling nicht nur die Geschichte ihrer Abberufung. Bruno Köhler hat seine Rezension des Buches freundlicherweise online gestellt. Er schreibt: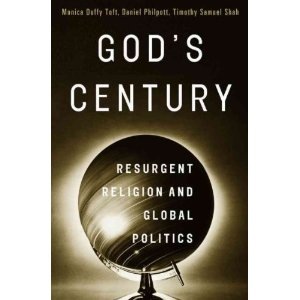 Die amerikanische Politikwissenschaftlerin Monica Toft prophezeit uns eine machtvolle Rückkehr der Religion in die Weltpolitik. DIE ZEIT hat Monica Duffy Toft gefragt:
Die amerikanische Politikwissenschaftlerin Monica Toft prophezeit uns eine machtvolle Rückkehr der Religion in die Weltpolitik. DIE ZEIT hat Monica Duffy Toft gefragt: