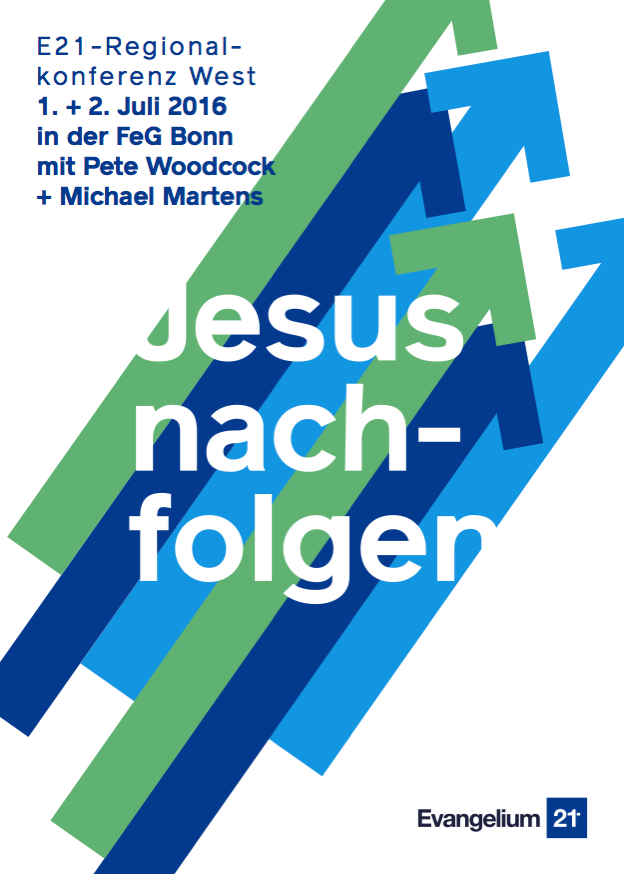Belinda Luscombe hat für die aktuelle Ausgabe des Time Magazine den alarmierenden Artikel „Porno und die Bedrohung der Männlichkeit“ verfasst. Sie beschreibt dort die erste Generation junger Männer, die mit uferloser Online-Pornographie aufwächst und vor ganz neuen Herausforderungen steht (leider ist der Artikel nicht frei zugänglich).
Kurz: Jugendliche kommen immer früher mit Pornographie in Berührung. Geschildert wird das Beispiel von Noah, der bereits mit 9 Jahren erste Videos heruntergeladen hat und mehrmals täglich Pornos konsumierte als er 15 war. Gemäß einer Studie der University of Bristol aus dem Jahre 2015 sehen fast 40% der Jungen aus Großbritannien im Alter von 14 bis 17 regelmäßig Pornos.
Irgendwann stimulieren diese Videos das Lustzentrum der Jugendlichen nicht mehr, was oft dazu verleitet, schärferes und sogar gewaltverherrlichendes Material zu konsumieren. Immer mehr Jugendlichen entwickeln mit der Zeit eine sogenannte „Porn-Induced Erectile Dysfunction“ (PIED). Sie verlieren also die Lust an der natürlichen Sexualität und sind unter Umständen auch gar nicht mehr in der Lage, diese zu erleben. So wird aus dem Pornokonsum eine Pornosucht. Die virtuelle Welt versperrt den Zugang zum Leben.
Belinda Luscombe:
Da die Jugendlichen, die die Pornographie verschlingen, das Material in einem Gehirn verdauen, das noch in der Entwicklung steckt, ist es möglich, dass sie besonders anfällig sind. Philip Zimbardo, emeritierter Professor für Psychologie an der Stanford University (und der Mann, der das berühmte Stanford-Prison-Experiment durchführte), stellt fest, dass Pornographie oft Hand in Hand mit Videospielen geht und ähnlich fein abgestimmt ist, um eine möglichst große Abhängigkeit zu erzeugen.
„Pornographie lässt dich in etwas versinken, was ich momentan als hedonistische Zeitzone bezeichne“, sagt er. „Du suchst die Lust und die Neuheit und lebst im Augenblick.“ Während sie nicht substanzungebunden süchtig macht, meint er, hat die Pornographie dennoch die gleiche Wirkung auf das Verhalten wie eine Drogenabhängigkeit: Einige Leute hören auf, sich um andere Dinge zu kümmern, nur damit sie ihrer Pornosucht nachgehen können. „Und dann ist das Problem, dass du mehr und mehr tust, da die Belohnungszentren des Gehirns die Fähigkeit zur Erregung verlieren“, fügt er an.
Belinda schildert anschließend verschiedenen Initiativen, die dabei helfen, aus der Sucht herauszukommen. Auch der eingangs genannte Noah unterstützt inzwischen Aussteiger und hat ein Buch dazu geschrieben. In diesem kurzen Video nennt er einige Punkte, die ihm dabei geholfen haben, wieder ein normales Leben zu führen:
Viele Tipps von Noah sind wirklich hilfreich. Freilich stehen Initiativen wie dieser die Ressourcen des Glaubens nicht zur Verfügung. Es fehlt die tiefere Analyse, zu der auch die Einsicht gehört, dass Pornographie eine Form des Götzendienstes ist und bei Jesus Christus Vergebung und Hilfe gefunden werden kann.
Inzwischen ist das Buch Finally Free: Fighting for Purity with the Power of Grace von Heath Lambert in deutscher Sprache erschienen. Der Verlag schreibt über die Publikation:
Kennen Sie den verzweifelten, aber anscheinend hoffnungslosen Kampf gegen die Faszination der Pornografie? Haben Sie je versucht, jemandem zu helfen, der in diesen verhängnisvollen Strudel geriet? Ist Ihnen bewusst, wie schwer es ist, davon loszukommen? Gibt es überhaupt echte Freiheit auf diesem Gebiet? Braucht man noch stärkere Bemühungen, einen festeren Entschluss, sich ändern zu wollen – oder neue Methoden und neue Programme?
Die gute Nachricht ist: Es gibt Einen, der Menschen wirklich frei machen kann, die der Pornosucht verfallen sind: Jesus Christus!
In diesem Buch beschreibt Dr. Heath Lambert acht biblisch fundierte Strategien zur Überwindung dieser Sucht. In jedem Kapitel weist er überzeugend nach, wie wichtig die biblischen Aussagen in diesem speziellen Kampf sind. Und er bezeugt, dass ungeachtet der Härte oder Länge des Kampfes der Herr jeden, der mit dem Wunsch nach Befreiung und der Sehnsucht nach einem Leben in Reinheit zu ihm kommt, frei machen kann. Er will es tun.
Daniel Röthlisberger hat zudem einen von verhaltenstherapeutischen Einsichten geprägten Ratgeber für Seelsorger verfasst.