Als der venezolanische Präsident Hugo Chávez seine dritte Präsidentschaft antrat, erklärte er, sein Ziel sei die Transformation der Gesellschaft in Richtung eines „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“. Beraten wurde er damals von dem deutschen Sozialwissenschaftler Heinz Dieterich, der das Werk Der Sozialismus des 21. Jahrhunderts 1996 verfasst hatte. DER SPIEGEL erklärte uns: „Hexenmeister Dieterich. Präsident Hugo Chávez profiliert sich als neue Lichtgestalt der Linken in Lateinamerika. Ein Alt-68er, der einst in Frankfurt studierte, hilft ihm dabei“.
Überhaupt überschlugen sich die Linken mit dem Lob für den Anwalt der Armen in Lateinamerika. DIE WELT berichtete im Jahr 2007:
Viele deutsche Linke unterstützen Chávez und sein Projekt des „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“. Denn in Venezuela scheint gerade das zu passieren, was man in Deutschland auch gerne erleben würden: eine echte Revolution.
Im Internetforum der Globalisierungskritiker von Attac etwa kann man lesen, Venezuela sei „ein praktisches Beispiel für die Zurückdrängung der neoliberalen Politik“. Ein anderer meint über Chávez, der im Jahr 2005 auch auf dem so genannten Weltsozialforum sprechen durfte, er sei „der beste Politiker, den es auf der ganzen Welt gibt“.
Auch die Partei „Die Linke“ unterstützt Chávez. Der europapolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Dieter Dehm, sagte im vorigen Jahr, als er auf Kuba zu Besuch weilte: „Was Chávez macht, ist auch der Weg, in Deutschland die ökonomischen Probleme zu lösen: das Energiemonopol der Energiekonzerne in öffentlichen Besitz zu verwandeln.“ Eine bolivarianische Revolution in der Bundesrepublik? Alle Probleme gelöst! Kein Scherz!
Oskar Lafontaine, der Vorsitzende der „Linken“, verteidigt auch die Einschränkung der Pressefreiheit in Venezuela. Als Kronzeugin gegen den Sender RCTV, dessen Lizenz Chávez kassiert hatte, führte Lafontaine im Sommer in der „Welt am Sonntag“ die Historikerin Dorothea Melcher an, die dem Sender „sehr üble Hetzkampagnen gegen Chávez“ bescheinigt hatte. Dass sich Pressefreiheit jedoch gerade daran misst, wie frei ein Sender ist, der nicht die Meinung der Regierung teilt, hat sich noch nicht bis zu Lafontaine herumgesprochen.
Die Restriktionen à la Chávez können für viele Linke das Bild von den „fortschrittlichen sozialistischen Regierungen wie in Venezuela“ (Lafontaine) und vom „charismatischen Präsidenten“ (Sarah Wagenknecht) nicht trüben.
2013 ist Hugo Chávez verstorben. Zurückgelassen hat er ein abgewirtschaftetes, völlig korruptes Land, das nun in den Abgrund schaut. Matthias Rüb, Lateinamerika-Korrespondent der FAZ mit Sitz in São Paulo, schreibt für seine Zeitschrift (FAZ vom 27.05.2016, Nr. 121, S. 1):
Die „roten“ Regierungen Lateinamerikas haben die Missstände nicht beseitigen können, die schon die Militärdiktaturen und Regime kultivierten, die sie einst stürzten: Die Sumpfblüten Korruption und Klientelismus wechselten einfach nur die Farbe. Beim Kampf um den Machterhalt waren auch den linken Caudillos alle Mittel recht, von der Verunglimpfung bis zur offenen Verfolgung des politischen Gegners. Die doppelte Lebenslüge der lateinamerikanischen Linken lautet, nur sie könne das Los der Marginalisierten verbessern und ein Machtwechsel bedeute den Rückfall in die historische Düsternis von Kolonialismus und Raubtierkapitalismus.
Jetzt rollt in Lateinamerika eine neue Welle heran. Symptomatisch dafür ist die Lage im Modellstaat des „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“. Wie sieht es dort aus? Nur wer stundenlang vor den staatlichen Supermärkten ansteht, kommt an Grundnahrungsmittel oder Toilettenpapier. Die Inflationsquote ist die höchste der Welt, sie dürfte bald siebenhundert Prozent erreichen. Vergangenes Jahr ist die Wirtschaft um zehn Prozent geschrumpft. In Apotheken und Krankenhäusern fehlt es an Medikamenten und Verbandsmaterial. In Staatsbetrieben und Verwaltungen wird nur noch montags und dienstags gearbeitet, um Strom zu sparen. Die Gewaltkriminalität ist außer Kontrolle. Die Hauptstadt ist eine der gefährlichsten Metropolen der Welt. Nur sechs Prozent der Morde werden aufgeklärt.
So sieht es in Venezuela aus.
Dabei verfügt das Land über die größten nachgewiesenen Ölreserven der Welt.
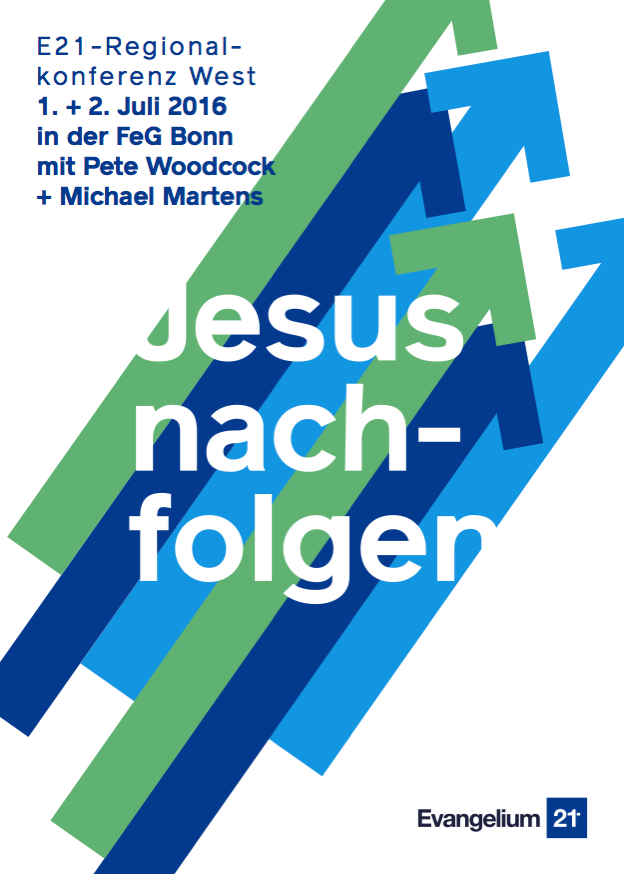
 Christopher Hitchens war ein Intellektueller, der insbesondere für seinen glühenden Hass auf Religionen und ganz besonders auf das Christentum bekannt war. Seine große Abrechnung mit dem christlichen Glauben ist als
Christopher Hitchens war ein Intellektueller, der insbesondere für seinen glühenden Hass auf Religionen und ganz besonders auf das Christentum bekannt war. Seine große Abrechnung mit dem christlichen Glauben ist als