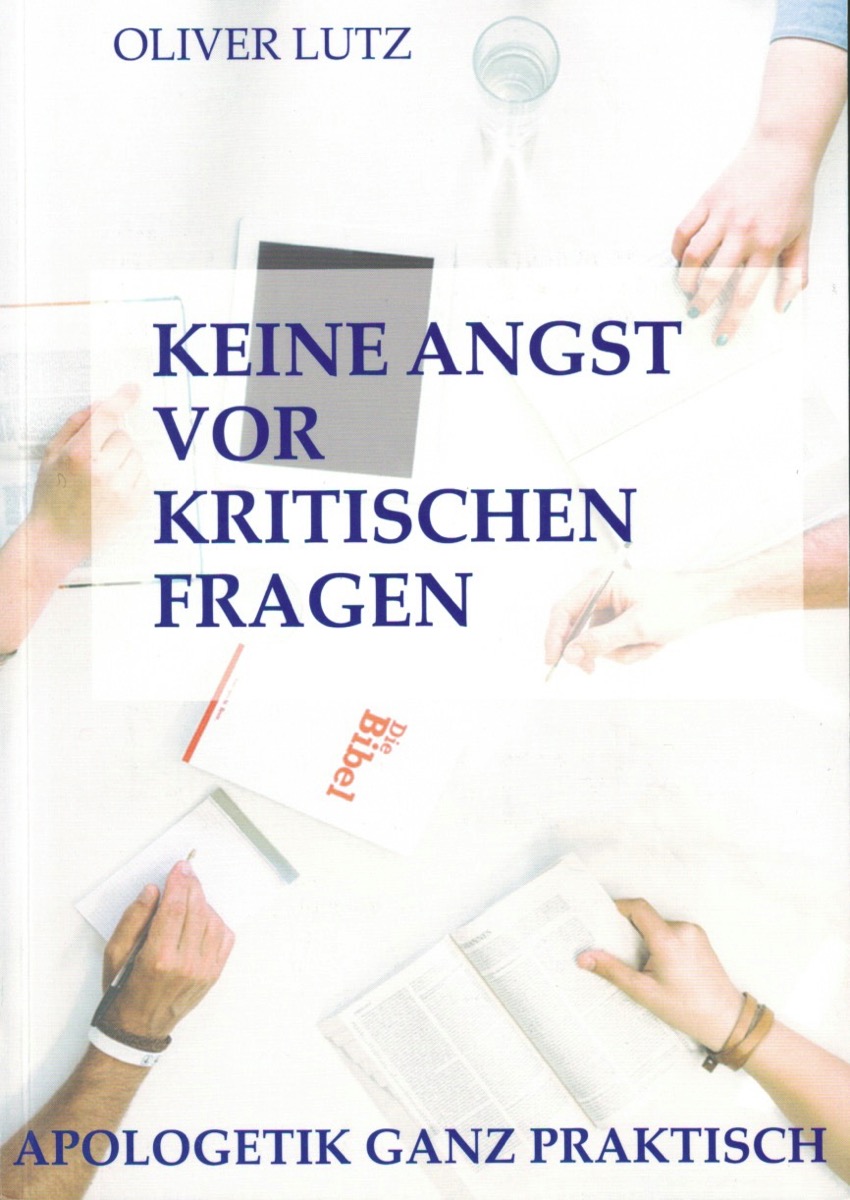 Die Verteidigung des christlichen Glaubens, in Fachkreisen Apologetik genannt, ist heutzutage wenig beliebt. Manche Theologen, zum Beispiel diejenigen, die in der Tradition der Neo-Orthodoxie stehen, lehnen sie aus Überzeugung ab. Der Glaube braucht ihrer Meinung nach nicht rational verteidigt zu werden. Die Verkündigung des Wortes Gottes reicht: „Von der heiligen Schrift her sind wir weder aufgefordert noch auch nur autorisiert, uns nach einer Bereitschaft Gottes für den Menschen umzusehen, die von der in der Gnade seines Wortes und Geistes verschieden wäre“, schrieb Karl Barth.
Die Verteidigung des christlichen Glaubens, in Fachkreisen Apologetik genannt, ist heutzutage wenig beliebt. Manche Theologen, zum Beispiel diejenigen, die in der Tradition der Neo-Orthodoxie stehen, lehnen sie aus Überzeugung ab. Der Glaube braucht ihrer Meinung nach nicht rational verteidigt zu werden. Die Verkündigung des Wortes Gottes reicht: „Von der heiligen Schrift her sind wir weder aufgefordert noch auch nur autorisiert, uns nach einer Bereitschaft Gottes für den Menschen umzusehen, die von der in der Gnade seines Wortes und Geistes verschieden wäre“, schrieb Karl Barth.
Die meisten Christen lehnen die Apologetik freilich nicht ab, weil sie Sören Kierkegaard oder Karl Barth gelesen haben, sonders deshalb, weil ihnen die Verteidigung des Glaubens zu knifflig erscheint. „Warum soll ich mich mit solchen anstrengenden Themen herumschlagen und auch noch glaubenskritische Bücher lesen?“, denken etliche unserer Mitarbeiter in den Gemeinden. Das ist natürlich schade, denn Fassetten der Apologetik gehören in alle Bereiche des Gemeindelebens, etwa zur Kinderarbeit, Predigt oder Seelsorge. Trotzdem kann ich die Zurückhaltung verstehen. Viele apologetische Bücher sind ziemlich dick und delikat, zahlreiche Ressourcen zudem nur in englischer Sprache zugänglich.
Oliver Lutz, Leiter des Schweizer Netzwerks „Züri Oberland“, hat vor einigen Wochen ein Buch veröffentlicht, das die Lücke zwischen den akademischen Abhandlungen und den Bedürfnissen von Jugendleitern oder Hauskreismitarbeitern schließt. Das Buch Keine Angst vor kritischen Fragen: Apologetik ganz praktisch ist als Kleingruppenheft konzipiert. Es greift viele der Fragen auf, mit denen sich Gruppenleiter herumplagen. Aufgegriffen werden etwa „Warum lässt Gott das zu?“, „Ein grausamer Gott im Alten Testament?“, „Ich bin Atheist“, „Führen alle Religionen zum selben Gott?“ oder „Ich bin ein guter Mensch“.
 Konzipiert sind die Lektionen so, dass zunächst in das Thema eingeführt wird. Anschließend werden vertiefende Denkanstöße geliefert und die Leser mit dem Blickwinkel ihrer kritischen Freunde vertraut gemacht. Der zweite Punkt ist belangvoll, da er hilft, uns in die „Denke“ unserer Kritiker hineinzuversetzen. Der biblisch begründeten Erörterung wird trotzdem besonders viel Raum gegeben. Oft werden Bibelstellen angeführt, die zu studieren sind und die die aufgeworfenen Fragen, oder zumindest Aspekte von ihnen, beantworten. Schließlich gibt es Anregungen für das Einüben der Antworten, gelegentlich wird dafür ein Rollenspiel vorgeschlagen.
Konzipiert sind die Lektionen so, dass zunächst in das Thema eingeführt wird. Anschließend werden vertiefende Denkanstöße geliefert und die Leser mit dem Blickwinkel ihrer kritischen Freunde vertraut gemacht. Der zweite Punkt ist belangvoll, da er hilft, uns in die „Denke“ unserer Kritiker hineinzuversetzen. Der biblisch begründeten Erörterung wird trotzdem besonders viel Raum gegeben. Oft werden Bibelstellen angeführt, die zu studieren sind und die die aufgeworfenen Fragen, oder zumindest Aspekte von ihnen, beantworten. Schließlich gibt es Anregungen für das Einüben der Antworten, gelegentlich wird dafür ein Rollenspiel vorgeschlagen.
Experten werden hier und da Feinheiten vermissen oder mit der ein oder anderen Antwort nicht zufrieden sein. Aber das spricht im Grunde für das Buch. Denn es ist nicht für Spezialisten geschrieben, sondern will eine alltagstaugliche Apologetik trainieren. Fallen dem ein oder anderen Leser oder Kleingruppen-Teilnehmer die Antworten zu simpel aus, findet er genug Hinweise auf vertiefende Literatur, die zusätzlich studiert werden kann.
Erfreulich ist, dass der Autor davon ausgeht, dass jeder Mensch von bestimmten Denkvoraussetzungen her argumentiert, es also keinen neutralen Standpunkt gibt, von dem aus Glaubensfragen beantwortet werden. Apologetik zielt genau auf diese Denkvoraussetzungen ab, nimmt also den Standort des Ungläubigen unter die Lupe und prüft ihn an der durch und durch vernünftigen christlichen Offenbarung. Ich hoffe, das Buch stimuliert Gemeinden und Kleingruppen dazu, apologetisch zu denken und damit gegenüber einer immer kritischer werdenden Gesellschaft sprachfähiger zu werden.

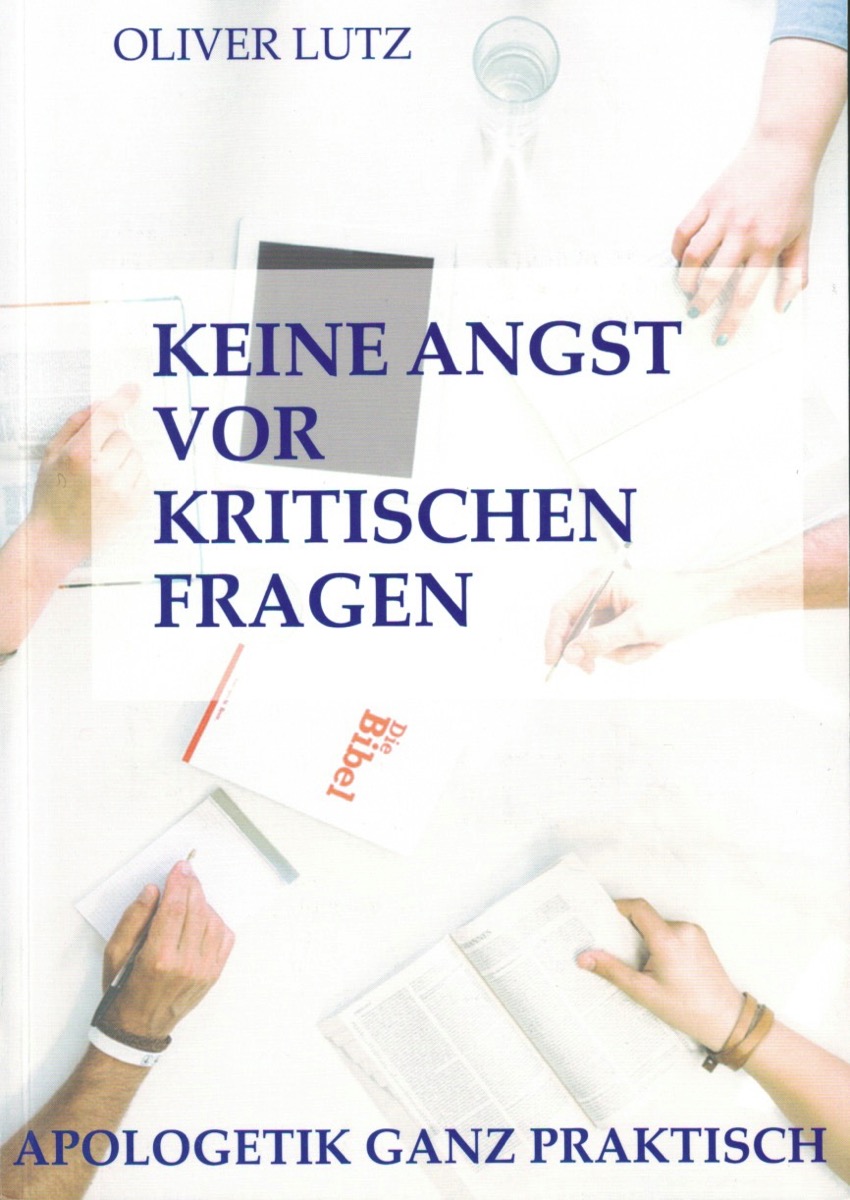 Die Verteidigung des christlichen Glaubens, in Fachkreisen Apologetik genannt, ist heutzutage wenig beliebt. Manche Theologen, zum Beispiel diejenigen, die in der Tradition der Neo-Orthodoxie stehen, lehnen sie aus Überzeugung ab. Der Glaube braucht ihrer Meinung nach nicht rational verteidigt zu werden. Die Verkündigung des Wortes Gottes reicht: „Von der heiligen Schrift her sind wir weder aufgefordert noch auch nur autorisiert, uns nach einer Bereitschaft Gottes für den Menschen umzusehen, die von der in der Gnade seines Wortes und Geistes verschieden wäre“, schrieb Karl Barth.
Die Verteidigung des christlichen Glaubens, in Fachkreisen Apologetik genannt, ist heutzutage wenig beliebt. Manche Theologen, zum Beispiel diejenigen, die in der Tradition der Neo-Orthodoxie stehen, lehnen sie aus Überzeugung ab. Der Glaube braucht ihrer Meinung nach nicht rational verteidigt zu werden. Die Verkündigung des Wortes Gottes reicht: „Von der heiligen Schrift her sind wir weder aufgefordert noch auch nur autorisiert, uns nach einer Bereitschaft Gottes für den Menschen umzusehen, die von der in der Gnade seines Wortes und Geistes verschieden wäre“, schrieb Karl Barth.
