„Den Namen dürft ihr nicht vergessen, Paul Schneider ist unser erster Märtyrer“, so warnte Dietrich Bonhoeffer eindringlich, als er erfuhr, dass sein Amtsbruder im KZ Buchenwald zu Tode gekommen ist (Bonhoeffer selbst wurde am 9. April vor 72 Jahren im KZ Flossenbürg ermordet).
Die Nazis haben Paul Schneider am 27. November 1937 in das neu errichtete KZ Buchenwald gebracht. Als er bei einem Appell anlässlich des Führergeburtstages am 20. April 1938 den Hitlergruß verweigerte, wurde er mit Stockschlägen bestraft und in eine Einzelzelle des Bunkergebäudes gesperrt. Trotz schwerster Misshandlungen durch Martin Sommer, den Henker von Buchenwald, unterließ er es nicht, aus seinem Gefängnis heraus das Evangelium zu verkündigen. Über ein Jahr wurde der „Prediger von Buchenwald“ in der Einzelzelle gefangen gehalten. Am 18. Juli 1939 hat ihn nach Berichten des Arztschreibers Walter Poller der Lagerarzt Erwin Ding-Schuler durch eine starke Überdosis eines Herzmedikaments ermordet.
 Am letzten Wochenende besuchte ich die Gedenkstätte Buchenwald und fand in der Zelle, die an Paul Schneider erinnert, einen Vers aus 2. Korintherbrief 5,20: „So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns; so bitten wir nun an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott!“
Am letzten Wochenende besuchte ich die Gedenkstätte Buchenwald und fand in der Zelle, die an Paul Schneider erinnert, einen Vers aus 2. Korintherbrief 5,20: „So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns; so bitten wir nun an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott!“
Nehmen wir uns zu Herzen, was Schneider in einem aus dem Konzentrationslager geschmuggelten Brief geschrieben hat:
Ich vergnüge mich mit Gottes Wort und Liedern, außer dem fast täglichen Reinemachen der Zellen, der Schlaf decken und Matratzen und dem Spazierengehen im Gefängnishof (eine halbe Stunde). So kann ich geistliche Schätze sammeln für neuen Dienst und ist die Zeit auch für mich nicht vergebens. Ich hoffe, sie ist auch für die Gemeinden nicht vergebens; dass doch viele möchten ihre geistliche Trägheit und Verantwortungsscheu überwinden! Dass Gott uns allen auch einen Geist der Buße schenken wolle und den Willen zu einem zuchtvollen Gemeindeleben mitten in dem abgöttischen Geschlecht unserer Tage! Wie vieles habe ich noch versäumt und hätte besser vorbereitet sein müssen für den nun eingetretenen und doch so lange vorausgeahnten Fall!
Das Zitat stammt aus dem Buch:

 Am letzten Wochenende besuchte ich die Gedenkstätte Buchenwald und fand in der Zelle, die an Paul Schneider erinnert, einen Vers aus 2. Korintherbrief 5,20: „So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns; so bitten wir nun an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott!“
Am letzten Wochenende besuchte ich die Gedenkstätte Buchenwald und fand in der Zelle, die an Paul Schneider erinnert, einen Vers aus 2. Korintherbrief 5,20: „So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns; so bitten wir nun an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott!“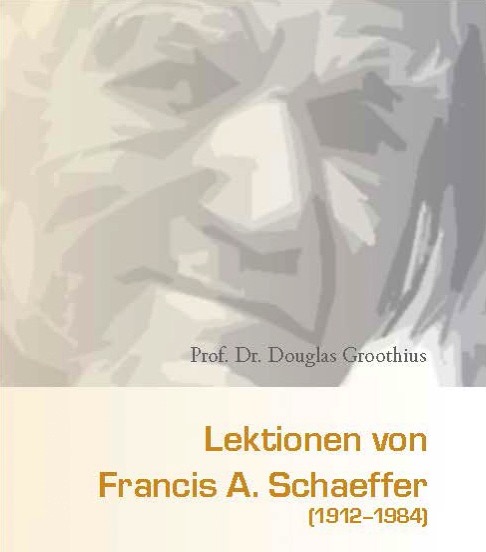 Im Jahr 2008 hat Professor Douglas Groothius in Glauben und Denken heute einen Artikel über Francis Schaeffer publiziert. Groothius hat sieben Lektionen aus dem Leben seines Lehrers herausgestellt:
Im Jahr 2008 hat Professor Douglas Groothius in Glauben und Denken heute einen Artikel über Francis Schaeffer publiziert. Groothius hat sieben Lektionen aus dem Leben seines Lehrers herausgestellt: