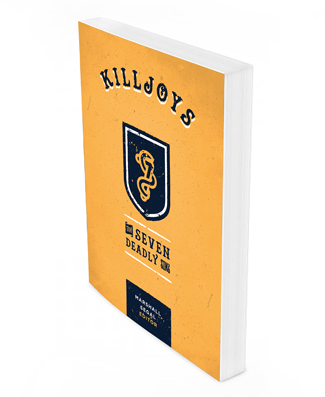Killjoys
Bei Desiring God gibt es das neue Buch Killjoys: Der Verlag schreibt dazu:
Our love affairs with sin are not just a matter of morality, but of joy. Sanctification is not just about faithfulness to God, but about finding our deepest, most satisfying fulfillment in him.
We can be infinitely and enduringly more happy with Jesus than with anything or even everything in a world without him — even when that world is filled and overflowing with promotions and bonuses at work, on-demand television, all-you-can-eat sushi, grossly accessible pornography, always new and better technology, and countless other goods become gods.
Our hearts were designed to enjoy a full and forever happiness, not the pitiful temporary pleasures for which we’re too prone to settle. Pride, envy, anger, sloth, greed, gluttony, and lust are woefully inadequate substitutes for the wonder, beauty, and affection of God. They will rob you, not ravish you. They will numb you, not heal you. They will slaughter you, not save you.
Das Buch, dessen Cover von dem großartigen Peter Voth gestaltet wurde, gibt es zum kostenlosen Download in verschiedenen Formaten hier: www.desiringgod.org.