Ich habe hier schon über das aktuelle Buch von Thomas Nagel berichtet. Jetzt ist das Thema auch in Deutschland angekommen. Sein Buch soll im Oktober in deutscher Sprache unter dem Titel Geist und Kosmos – Warum die materialistische neodarwinistische Konzeption der Natur so gut wie sicher falsch ist beim Suhrkamp Verlag erscheinen. Der Verlag schreibt darüber:
Über eines sind sich die meisten Naturwissenschaftler heute einig: Das Bild, das die exakten Wissenschaften – insbesondere Physik und Evolutionsbiologie – von der Welt zeichnen, ist im Wesentlichen korrekt und alles, was existiert, kann im Prinzip mit deren Methoden erklärt werden. Und in der Tat: Die Fortschritte, die diese materialistische Standardtheorie vorzuweisen hat, sind beträchtlich. Aber es gibt auch noch Lücken: Der menschliche Geist zum Beispiel findet darin bislang keinen rechten Platz. Ein reiner Schönheitsfehler? Nur eine Frage der Zeit? Nein, sagt Thomas Nagel, und bläst in seinem neuen Buch zum Generalangriff auf die etablierte naturwissenschaftliche Weltsicht. Ihr Problem, so seine These, ist grundsätzlicher Natur: Das, was den menschlichen Geist auszeichnet – Bewusstsein, Denken und Werte –, lässt sich nicht reduzieren, schon gar nicht auf überzeitliche physikalische Gesetze. Daher bleibt eine Theorie, die all dies nicht erklären kann, zwangsläufig unvollständig, ja, sie ist mit ziemlicher Sicherheit falsch. Um dies zu begründen, durchmisst Nagel die schwierigen Fragen der Philosophie des Geistes, der Erkenntnistheorie und der Theorie der Werte. Stück für Stück zeigt er mit subtilen philosophischen Argumenten auf, wo und warum der reduktive Materialismus zu kurz greift, und entwickelt erste Ansätze für eine völlig neue Perspektive auf Geist und Kosmos. Das ist so gewagt wie beeindruckend. Philosophie pur.
Malte Lehmig schreibt für CICERO:
Nagel nennt die Auffassungen, gegen die er leidenschaftlich und gleichwohl kühl und trocken anschreibt, abwechselnd psychophysikalischen Reduktionismus, Materialismus und Naturalismus. „Ich finde diese Sicht unglaubhaft“, schreibt er, sie sei der „heroische Triumph einer Ideologie über den Wirklichkeitssinn“. Als Grund für diesen Triumph vermutet er die Fortschritte der Naturwissenschaftler auf den Gebieten der Neurophysiologie und Molekularbiologie. Dadurch sei die übermütige Hoffnung genährt worden, auch sämtliche Phänomene des Geistes unter eine einzige physikalische Konzeption der Welt subsumieren zu können. Nagel hält das für unmöglich. Kaum gnädiger urteilt er über die Evolutionstheorie. Sie sei zwar nicht falsch, aber ungenügend. Die „ganze Wahrheit“ werde von ihr nicht erfasst. Denn die im Prinzip ziellose Abfolge von Mutation und Selektion könne nicht ausreichend erklären, wie aus anorganischem organisches Leben entstand, aus einfachen Systemen komplizierte wurden und Instinkt in Verstand und Bewusstsein mündete. „Organismen wie die unseren haben nicht einfach nur zufällig Bewusstsein.“ Die Lehre Darwins müsse folglich ergänzt werden durch teleologische Hypothesen, oder anders gesagt: einer „kosmischen Prädisposition der Entstehung von Leben, Bewusstsein und den Werten, die sich davon nicht trennen lassen“. Teleologie meint in diesem Zusammenhang: Dinge geschehen auch, weil sie auf dem Weg zu einem Ziel liegen.
Hier: www.cicero.de.
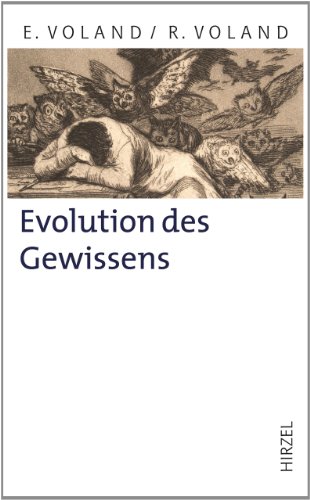 Eckart Volant und Renate Volant haben ein Buch über die Entstehung des menschlichen Gewissens geschrieben. Ihre naturalistisch-freudianische Deutung der Gewissensgenese geht ungefähr so:
Eckart Volant und Renate Volant haben ein Buch über die Entstehung des menschlichen Gewissens geschrieben. Ihre naturalistisch-freudianische Deutung der Gewissensgenese geht ungefähr so: