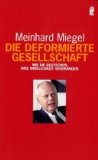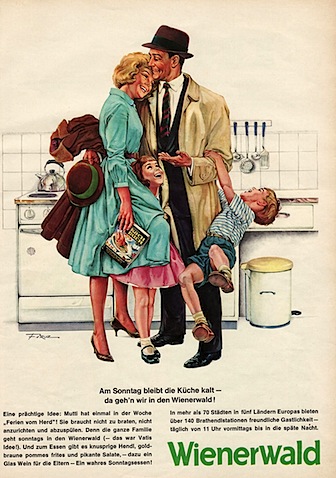Folgen einer Scheidung sind über Generationen wirksam
Das »Institut für Demographie, Allgemeinwohl und Familie« schreibt im aktuellen Newsletter:
Jedes Jahr erleben etwa 200.000 Kinder in Deutschland, dass sich ihre Eltern trennen. Als Folge des Zerbrechens von Ehen und Beziehungen wachsen mittlerweile etwa ein Fünftel der Kinder in den alten und ein Drittel der Kinder in den neuen Bundesländern nicht mehr mit beiden leiblichen Eltern zusammenlebend auf (1). Lange bestand Konsens darüber, dass Trennungen der Eltern Kinder schwer belasten und die »Festigkeit der Kernfamilie« für ihr Wohlergehen wesentlich ist. Befürwortern eines neuen Leitbilds der »sozialen Elternschaft« gilt dagegen die »Orientierung der Öffentlichkeit am alten Ideal der Kernfamilie« (Renate Schmidt) als »überholt«. In diesem Sinne betont der 7. Familienbericht der Bundesregierung, dass eine gesunde Entwicklung von Kindern »mit einem breiten Spektrum familialer Lebensformen vereinbar« sei (2). Aus dieser Sicht sollen Trennung und Scheidung »entdramatisiert und als zu bewältigende Erfahrung konzipiert« werden. Früher habe sich die Analyse von Scheidungen zu sehr auf die »negativen Auswirkungen, atypische und sogar pathogene Entwicklungstendenzen der Familie« konzentriert. Heute sehe man dagegen »im Übergang neben Dysfunktion gleichermaßen das Potential für Stimulation und entwicklungsbezogenes Wachstum gegeben«. »Kritische Lebensereignisse« wie die Scheidung böten die Chance, »Beziehungen und die Lebenssituation neu und oftmals für alle Beteiligten befriedigender zu organisieren« (3). Gleichzeitig muss der Expertenbericht jedoch einräumen, dass Scheidungen zu den »am meisten belastenden Lebensereignissen von Kindern« zählen. Insbesondere die anfängliche Phase der Elterntrennung sei »für die große Mehrheit der Kinder recht belastend«, zumal die meisten Kinder »auf die Elterntrennung emotional nicht vorbereitet« seien. Trennungen der Eltern beeinträchtigten »das Selbstwertgefühl der Kinder, soziale und kognitive Kompetenzen sowie die schulischen Leistungen«. Scheidungskinder zeigten »vermehrte Tendenzen zu externalisierenden und internalisierenden Bewältigungsstrategien«, sie werden also häufiger psychisch auffällig (4). Vor allem männliche Scheidungswaisen sind anfälliger für Drogenkonsum, Delinquenz und Gewalt. Zwar verhalten sich in der Adoleszenz auch Kinder aus äußerlich intakten Kernfamilien nicht selten destruktiv und antisozial. Im Vergleich zu diesen ist das »Risiko von Anpassungsproblemen« bei Scheidungskindern im Vergleich jedoch mindestens doppelt so hoch (5).
Hier der vollständige Text: www.i-daf.org.