 Der Theologe Georg Hermann Huntemann ist am 13. Februar 2014 in Bremen verstorben. Von 1970 an war er Professor für Ethik und Apologetik an der Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule Basel (STH) und von 1985 bis 1995 an der Evangelische Theologische Faculteit, Leuven (ETF). Auch wenn Prof. Huntemann gelegentlich „hitzig“ werden konnte, hat er viele Theologen nachhaltig in guter Weise geprägt.
Der Theologe Georg Hermann Huntemann ist am 13. Februar 2014 in Bremen verstorben. Von 1970 an war er Professor für Ethik und Apologetik an der Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule Basel (STH) und von 1985 bis 1995 an der Evangelische Theologische Faculteit, Leuven (ETF). Auch wenn Prof. Huntemann gelegentlich „hitzig“ werden konnte, hat er viele Theologen nachhaltig in guter Weise geprägt.
Als er wegen seiner klaren Predigten 1967 die St. Remberti Gemeinde in Bremen verlassen musste, schrieb DIE ZEIT über ihn:
Als der Möbelwagen kam, lag der Pastor fiebernd im Bett. Sein Sinn für Wirkung aber war ungebrochen. „Ich ließ die Möbelpacker das Bett und mich in die Mitte des Zimmers rücken. Als dann im leeren Raum nur noch das Bett und ich übrig waren, erhob ich mich und fuhr in die neue Wohnung. Dort ging es dann in umgekehrter Reihenfolge: das Bett und ich waren zuerst da.“
Dr. Dr. Georg Huntemann, ein Troublemaker unter den evangelischen Theologen in Bremen, hatte den Möbelwagen unfreiwillig freiwillig bestellt. Sein Auszug aus der Jahrhunderte alten Gemeinde von St. Remberti hat in der zu mehr als achtzig Prozent evangelischen Hansestadt heiße Debatten entfesselt und die Frage nach theologischen Lehrmeinungen und kirchlichem Freiheitsverständnis neu belebt.
Der 38 Jahre alte, barttragende Pastor Huntemann bezeichnet sich selbst als einen Gewandelten, „von der modernen Theologie hin zur konservativ-orthodoxen“. Moderne Theologie – sagt er – bedeutet „Auflösung“. „Ich habe mich in der Abkehr von liberalen und modernistischen Denkvoraussetzungen zu der Erkenntnis durchgerungen, daß nur die vorbehaltlose Bindung an die ganze Heilige Schrift Alten und Neuen Testamentes die Basis unseres Christusglaubens sein kann, und daß keine zeitbedingte, also auch keine sogenannte moderne Weltanschauungsform, diesen Heilsweg versperren darf.“ Wenn Huntemann predigt, ist die Kirche überfüllt, wenn er Vorträge hält – über Sex, Satan, Sünde – gibt es in großen Sälen keinen freien Platz. Billy Graham gehört zu seinen Vorbildern.
Gemeinsam mit zwei Amtsbrüdern hat Georg Huntemann zehn Jahre lang bei St. Remberti gewirkt, bei einer Gemeinde, der – so der dienstälteste Remberti-Geistliche – „von ihrer liberalen Tradition her, Lithurgismus und Klerikalismus ein Greuel ist“. Nach Ansicht seines theologischen Gegenspielers hat Huntemann sich vom „Liberalen“ zum „Fundamentalisten“ entwickelt und damit die Gemeinde an den Rand einer „vergiftenden Spaltung“ gebracht.
Hier ein Auszug aus seinem Buch Angriff auf die Moderne (1966, S. 89–91):
Welchen Sinn hat es, Opfer zu bringen?
Solange es Menschen gibt, solange gibt es Opfer. In der Bibel lesen wir gleich auf den ersten Seiten, daß Kain und Abel Gott Opfer darbrachten. Opfer bedeutet, daß etwas aus dem Verfügungsbereich des Menschen genommen wird. Wer opfert, nimmt sich selbst etwas weg, um es Gott zu geben.
Opfern in diesem religiösen Sinne hat für den modernen Menschen keinen Sinn mehr. Für ihn ist ja Lebensziel nicht hergeben, sondern herholen, hinnehmen, behalten — kurzum »haben«! Aus diesem Grunde ist der Mensch maßlos erschreckt, wenn er — gegen seinen Willen — etwas hergeben muß, oder wenn ihm etwas genommen wird (z. B. Gesundheit, Besitz oder dgl.).
Ganz anders der Christ: Sein »Haben« ist ihm geschenkt. Wenn er etwas besitzt, dann hat er nicht das Gefühl, daß es ihm gehört. Er versteht es als Geschenk Gottes. Der Christ identifiziert sich auch nicht mit dem, was ihm gegeben ist.
Selbstverständlich kann diese innere Einstellung gegenüber den Dingen nur durch eine fortwährende seelische Aufopferung erhalten werden. Nur wenn man sich immer wieder klar macht, daß alles, was ich habe, außerhalb meines Verfügens steht, und nur dann, wenn ich bereit bin, es mir von Gott nehmen zu lassen, gewinne ich das rechte Verhältnis zu den Dingen in meinem Leben. Krankheit, Verzicht und die vielen Niederlagen des Lebens sind eine Hilfe Gottes in diesem Versuch, der Welt gegenüber frei zu bleiben.
Christus hat sich in seinem stellvertretenden Leiden und Sterben für die Menschheit dahingegeben. Für unsere Lebens- und Welteinstellung können wir daraus diese Folgerung gewinnen: Im absoluten Nullpunkt unseres Daseins erlangen wir die Hinwendung zu Gott, wenn wir diesen Weg im Blick auf Christus als Weg des Heils verstehen. Alles aufopfern heißt: Vertrauen setzen nicht mehr auf die Welt, auch nicht auf den Mitmenschen, nicht einmal auf mich selbst, sondern allein auf Gott.
Jesus ruft uns zu, daß nur der seiner wert ist, der bereit ist, Vater und Mutter um seinetwillen zu verlassen. Von dem reichen Jüngling verlangt er, daß er alles aufgibt, um ihm nachzufolgen. Was hier verlangt wird, ist Opfer. Dieses Opfer bringt der Christ nicht, um die Welt (etwa Vater und Mutter) zu verachten. Vielmehr wird ein Lebensbereich des Menschen Gott geopfert, zu Gott in Beziehung gesetzt, ihm anheim gegeben.
Christus hat sein Leben hingegeben und hat es gewonnen. Das Kreuz ist das Zeichen des Nein, der Qual, der Vernichtung. Es ist aber auch gleichzeitig Zeichen des Lebens. Die alte Kirche sah im Kreuz den Lebensbaum, der im Paradies stand. In der Tat ist das Kreuz beides: Der Baum der Marter und der Baum des Lebens. Hier offenbart sich das christliche Weltverständnis: Durch Schmerz und Leid geht der Weg zum Leben.
Die Welt ist in der Tat eine zwiespältige Welt. Ist sie deswegen ein Beweis gegen Gott?
Die Welt wäre ein Beweis gegen Gott, wenn es nicht das Zeichen des Kreuzes gäbe. Allein unter dem Zeichen des Kreuzes kann die Welt in ihrer Zwiespältigkeit verstanden werden, weil man allein angesichts des Kreuzes erfährt, daß der Weg zum Ja durch das Nein führt. Nicht nur der Mensch muß durch das Nein zum Ja, sondern die ganze Kreatur zittert und bangt, um durch den Schmerz hindurch zur Erlösung, zum Anbrechen des neuen Kosmos zu gelangen.
Diese Erlösung ist der Weg Christi. Weil diese Welt eine zwiespältige Welt ist, kann man aus ihr Gott nicht ablesen. Den offenbaren Gott erkennen wir nur angesichts des Kreuzes. Das Kreuz über dem Kosmos zeigt eine Welt, die in ihrer Wandlung durch Leiden und Sterben hindurch den Weg der Auferstehung beschreitet.
Luther schreibt im Blick auf Kreuz, Tod, Höllenfahrt und Auferstehung Christi: Christus »Herr geworden aller Dinge, auch des Todes und der Hölle, so müssen auch wir als seine Glieder durch seine Auferstehung getroffen und angerührt werden und eben des teilhaftig werden, was er damit ausgerichtet hat, als um unsertwillen geschehen. Und wie er durch seine Auferstehung alles mit sich genommen, daß beide, Himmel und Erde, Sonne und Mond, muß neu werden, so wird er auch uns mit sich führen.«
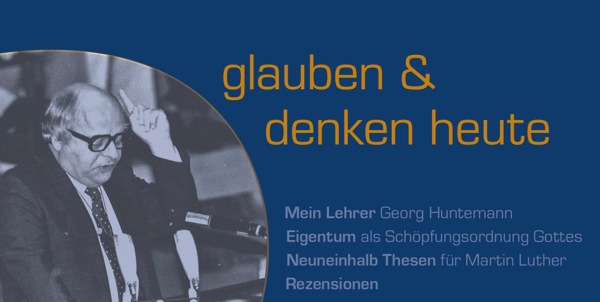 Die 13. Ausgabe der Online-Zeitschrift Glauben & Denken heute (1/2014) ist erschienen und ist vor allem dem Andenken an den kürzlich verstorbenen Theologieprofessor Georg Huntemann gewidmet, über den Prof. Dr. Thomas Schirrmacher als sein Schüler schreibt. Darüber hinaus widmet sich Prof. Dr. Thomas K. Johnson dem Thema Dreieinigkeit. Prof. Schirrmacher äußert sich zudem zu dem Familienpapier der EKD. Dr. Facius begegnet in seinem Beitrag der Kritik an Martin Luther anlässlich des Reformationsjubiläums. So geht Facius der Frage nach, ob Luther sich gegen die Marktwirtschaft gewendet habe:
Die 13. Ausgabe der Online-Zeitschrift Glauben & Denken heute (1/2014) ist erschienen und ist vor allem dem Andenken an den kürzlich verstorbenen Theologieprofessor Georg Huntemann gewidmet, über den Prof. Dr. Thomas Schirrmacher als sein Schüler schreibt. Darüber hinaus widmet sich Prof. Dr. Thomas K. Johnson dem Thema Dreieinigkeit. Prof. Schirrmacher äußert sich zudem zu dem Familienpapier der EKD. Dr. Facius begegnet in seinem Beitrag der Kritik an Martin Luther anlässlich des Reformationsjubiläums. So geht Facius der Frage nach, ob Luther sich gegen die Marktwirtschaft gewendet habe: Der Theologe Georg Hermann Huntemann ist am 13. Februar 2014 in Bremen verstorben. Von 1970 an war er Professor für Ethik und Apologetik an der Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule Basel (STH) und von 1985 bis 1995 an der Evangelische Theologische Faculteit, Leuven (ETF). Auch wenn Prof. Huntemann gelegentlich „hitzig“ werden konnte, hat er viele Theologen nachhaltig in guter Weise geprägt.
Der Theologe Georg Hermann Huntemann ist am 13. Februar 2014 in Bremen verstorben. Von 1970 an war er Professor für Ethik und Apologetik an der Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule Basel (STH) und von 1985 bis 1995 an der Evangelische Theologische Faculteit, Leuven (ETF). Auch wenn Prof. Huntemann gelegentlich „hitzig“ werden konnte, hat er viele Theologen nachhaltig in guter Weise geprägt.