»Ich esse gerade ein Eis«
Soziale Netzwerke liefern uns die Welt frei Haus. Aber die Nähe ist trügerisch. Von der wirklichen Welt sind nur noch Tweeds wie »Ich esse gerade ein Eis« übrig geblieben. Uns droht die Verbitterung.
Hier ein Artikel von Jörg Wittkewitz über die postmoderne Völkerwanderung in einer Kultur des wahren Mülls:
Dank Googles Algorithmen bestimmen wir den Preis der Anzeigen für Online-Magazine und Suchoberflächen durch unser eigenes Verhalten im Netz. Gleichzeitig zementieren wir damit auch unsere eigene Sicht auf die dort vermittelte Sicht auf die Welt. Denn seit Günther Anders und Jean Baudrillard ist es offensichtlich, dass wir nur noch einen medial aufbereiteten Blick auf die Welt haben. Und der direkte Kontakt ist nicht erst durch die digitalen Codes verstellt worden. Anders hatte in seinem Buch »Die Antiquiertheit des Menschen« Mitte der fünfziger Jahre am Beispiel des Fernsehens erkannt, dass uns die Welt nunmehr als Ware mit ästhetisch geformten Stilmitteln präsentiert wird. Der Warencharakter der künstlichen Welt drückt sich aber besonders darin aus, dass man per Knopfdruck darüber entscheiden kann, ob und wann man die Welt nun sehen will oder eben nicht.
Was damals die Kanalwählschalter der ersten Fernseher waren, ist heute unsere Computer-Maus. Sie wählt den Kanal aus, der ein harmonisches Übereinstimmen mit unseren Wünschen liefern kann. So lesen konservativ eingestellte Leser Zeitungen, Bücher und Websites, die diesen Lebensstil begründen können. Progressive Menschen bevorzugen die Herausforderungen mit dem ständigen Blick auf die drohende Zukunft. Dazwischen befindet sich eine große Menge von Menschen, die durch den modernen Hochleistungs-Lebensstil so erschöpft sind, dass sie den Zeitpunkt des Tiefschlafs nur noch mit künstlicher Berieselung herauszögen können. In diesem, dem Wachkoma ähnlichen Zustand sind sie höchstens noch in der Lage, kohlenhydratreiche Kost und Unterhaltung zu konsumieren.
Mehr: www.faz.net.
 Die Zeitschrift Christianity Today hat mit Tim Challies (siehe auch
Die Zeitschrift Christianity Today hat mit Tim Challies (siehe auch 
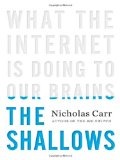 Durch das Internet akzeptieren wir bereitwillig den Verlust von Konzentration und des Fokus bei unseren Denkprozessen, behauptet Nicholas Carr in seinem letzten Buch
Durch das Internet akzeptieren wir bereitwillig den Verlust von Konzentration und des Fokus bei unseren Denkprozessen, behauptet Nicholas Carr in seinem letzten Buch  Ein Interview mit dem Soziologen Dirk Baecker über die medialen Herausforderungen der Zukunft (Hervorhebung von mir):
Ein Interview mit dem Soziologen Dirk Baecker über die medialen Herausforderungen der Zukunft (Hervorhebung von mir):