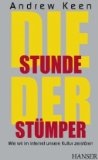Internet: Kultisches Netzwerk
Das Internet wird zum Religionsersatz. Wer »surft«, sucht oft nicht primär Information, sondern Sicherheit, Vertrautheit und Gewissheit. Das verändert unser Gottesbild.
Hier ein Auszug aus dem Essay von dem Medienwissenschaftler Norbert Bolz:
Vor diesem Hintergrund wird auch die Bedeutung des Zauberworts »Interaktivität« klar. Je interaktiver ein Medium ist, desto unwichtiger wird die Information. Die Botschaft lautet im Extremfall nur noch: Wir kommunizieren. Marketingexperten haben dafür schon einen neuen, eleganten Begriff gefunden: »linking value«. Dieser soziale Mehrwert der »Links« im Internet macht deutlich, dass den Menschen die Beteiligung an Kommunikation wichtiger ist als die Information. Und häufig genug trifft man auf den Grenzwert dieser Verdrängung von Information: Kommunikation kommuniziert Kommunizieren. Was haben Diplomatie, Talkshows und das protestantische »Reden wir miteinander« gemeinsam? Wichtiger als die Information ist die Beteiligung an Kommunikation.
Schon zu Luthers und Gutenbergs Zeiten hat die Religion von Kult auf Kommunikation umgestellt. Heute haben wir eine interessante Ersatzreligion: Kommunikation als Kult. Und nicht nur im Internet. Auch Politik hebt sich in Rhetorik auf. Von Kirchenmännern hört man nur noch »reden wir darüber«, und Talkshows verwirklichen die romantische Utopie vom unendlichen Gespräch.
Das Internet, aber auch alte Medien wie das Fernsehen präsentieren heute Information als Fetisch und Kommunikation als Kult – bei Anne Will nicht anders als in den Chatrooms. Nicht was, sondern dass geredet wird, zählt. Wenn Menschen im Internet surfen, geht es ihnen nicht vorrangig darum, Informationen aufzunehmen oder auszutauschen. Sie wollen gerade in der Redundanz der Botschaft »mitschwingen«, oben auf der Welle bleiben. Es geht nicht um Kommunikation, sondern um Faszination.
Für immer mehr Menschen ersetzen die sozialen Netzwerke die Religion. Dass das so einfach möglich ist, lässt sich ganz leicht erklären. Genau wie die Religion verleiht die Kommunikation den Menschen in erster Linie Weltvertrauen. Es geht hier nicht primär um Informationsübertragung, sondern um Sicherheit, Vertrautheit und Gewissheit. Dass Kommunikation in sozialen Netzwerken als Religionsersatz funktioniert, lässt aber auch umgekehrt vermuten, dass die Theologie am besten geeignet sein könnte, die neue Internetgesellschaft zu beschreiben. Gerade Theologen könnten erkennen, dass in den Bindungen der Netzwerke, die man »Links« nennt, genau das gesucht wird, was einmal »religio« hieß. Marshall McLuhans berühmter Satz »Das Medium ist die Botschaft« müsste heute heißen: Das Netzwerk ist die Frohe Botschaft.
Hier der vollständige Text: www.merkur.de.
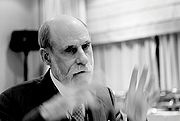 Vinton G. Cerf, früher Chefentwickler des IP-Internetprotokolls und damit »Vater des Internets«, äußert sich in einem FAZ-Interview über das Internet von morgen und die zunehmende Zensur:
Vinton G. Cerf, früher Chefentwickler des IP-Internetprotokolls und damit »Vater des Internets«, äußert sich in einem FAZ-Interview über das Internet von morgen und die zunehmende Zensur: