Martin Hengel: Jesus als Vollender
Martin Hengel schreibt („Jesus und die Tora“, Theologische Beiträge, Jahrgang 9, 1978, S. 152–172):
Seine endzeitliche Funktion macht nach dem Urteil Jesu den Täufer zu dem Größten unter den vom Weibe Geborenen, „aber der Kleinste in der Gottesherrschaft ist größer als er“ (Mt. 11,11–Lk. 7,28). Ganz gleich wie dieses rätselhafte Wort Jesu zu deuten ist, ob auf Jesus selbst oder auf die, die an der Gotte herrschaft teilhaben, es zeigt ebenfalls das qualitativ Neue, Andersartige, das mit der Zeit der Erfüllung, dem Anbruch der Gottesherrschaft verbunden ist. Da kommt auch in dem Makarismus Jesu zum Ausdruck „Selig sind die Augen, die sehen, was ihr seht (und die Ohren, die hören, was ihr hört), denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht, und sahen es nicht, und wollten hören, was ihr hört, und hörten es nicht“ (Lk. 10,23 f.). Das Sehen und Hören bezieht sich auf Jesu Taten und Worte, die selbst schon Teil der Erfüllung sind. Denn mit seinem Auftreten ist die Gottesherrschaft schon im Anbruch: „Wenn ich mit dem Finger Gottes die Dämonen austreibe, dann ist die Gottesherrschaft zu euch gekommen“ (Lk. 11,20). Sie „kommt nicht mit der Beobachtung (äußeren Vorzeichen)“, denn sie „ist mitten unter euch“ – in der Person Jesu, ihr begreift es nur nicht (Lk. 17, 20 f.). Die Kontrastgleichnisse zeigen gerade im Kontrast auch die Kontinuität zwischen dem äußerlich unscheinbaren Wirken Jesu und der Vollendung der Gottesherrschaft „in Kraft” (Mk. 9,1). Das bedeutet aber, daß es ein grundlegender Irrtum war, in Jesus eine nichtmessianische Gestalt zu vermuten, in ihm den bloßen „Rabbi und Propheten“ sehen zu wollen. Auch die von Conzelmann eingeführte Kategorie des „letzten Rufers“ (RGG3 3,633) reicht nicht aus, sie sollte eher auf den Täufer bezogen werden. Jesus tritt nicht mit dem Anspruch auf, letzter Rufer, sondern – messianischer – Vollender zu sein.
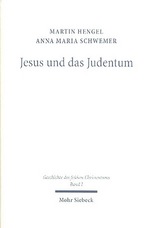 Das Buch:
Das Buch: Es ist schon merkwürdig: Einer der weltweit bedeutendsten Experten für Literatur des Urchristentums und antiken Judentums, Prof. Martin Hengel, ist gestorben (siehe
Es ist schon merkwürdig: Einer der weltweit bedeutendsten Experten für Literatur des Urchristentums und antiken Judentums, Prof. Martin Hengel, ist gestorben (siehe 